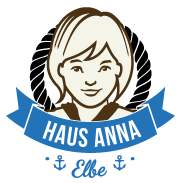Gegen Windmühlen / Balken wie Butter
Buch: Kapitel 04
Komplett. Dieses Wort soll uns noch zu denken geben. Was das heißt: komplett.
Wiktionary
Bedeutungen:
1. bezogen auf eine Gesamtheit: vollständig; das Ganze umfassend
2. bezogen auf eine Gesamtheit aus gleichartig Abzählbarem: vollzählig
3. adverbielle Verwendung: völlig
Synonyme:
Keine
Synonyme: Keine. So ist es. Auch keine Alternativen. Das geht nur komplett oder gar nicht. Das ganze Haus. Leben.
2015. Nach den ersten Wochen im Mietshaus in Kirchwerder besinnen wir uns auf unsere Mammutaufgabe: das alte Haus muss neu. Wo fängt man an? Der Architekt, richtig.
Zum Glück hatten wir über die ganzen Jahre, in denen wir ein Haus suchten, viele Gespräche mit vielen Menschen, die auch in alten Häusern leben oder ähnliches planten wie wir. Dort sind auch immer mal wieder Namen von Architekten gefallen. Und so kontaktierten wir den ein oder anderen auch schon bei vorherigen Haus-Versuchen. Bei einem aus der Nähe sind wir hängen geblieben. Er scheint uns am passendsten und wird jetzt konkret für den Auftrag angefragt. Er freut sich und willigt ein.
Bei der ersten Besichtigung kommt er aus dem Staunen gar nicht mehr raus und bestätigt uns, ähnlich wie der Denkmalschützer, dass dies ein ganz besonderes Haus ist.
Eines Tages, an einem Wochenende, fahre ich allein zum Haus, um mir einen Überblick zu verschaffen. Hier stehe ich nun also. Ich stehe, also bin ich. Ein Moment, in dem sich das Universum auftut. Ganz leise und kaum merkbar. Flüchtig. Wenn man nicht genau hinfühlt, ist er auch ganz schnell wieder vorbei und man war gar nie richtig da. Wie so oft im Leben. Aber bei aller Aufregung merke ich doch, ja, das jetzt und hier ist etwas sehr Besonderes. Denn nach all den Jahren an Träumen, Versuchen, Suchen, Verlieren und Wiederfinden, Hinfallen und Aufstehen, ist das jetzt hier unser Haus. Unser Traum, unser Märchen, das wir jetzt mit Leben füllen wollen.
Dieses Haus. Wie es so dasteht. Ganz still, als ob nie etwas gewesen wäre. Aber was hat es in über 300 Jahren alles erlebt. Was steckt in den Balken, welches Leben hat die alte Diele bewahrt und wie viel Leben ist in den kleinen Zimmerchen vor den Wohndiele entstanden. Ganz ruhig und ganz still. Alles gelb, pastellgelb. Dieses seichte verbleichte Gelb im Flett – das ist die Wohndiele neben der Wirtschaftsdiele – das ist mir tief in Erinnerung geblieben. Diese ruhige und stille Atmosphäre. Einzigartig. Und erwartungsvoll. Du weißt, dass da was kommt, und doch hast du keine Ahnung. 300 Jahre sind eine lange Zeit. Was sind 30 Jahre? Wie lange lebe ich hier noch mein Leben? Was mache ich da jetzt mit?

Und wie nähere ich mich der ganzen Sache jetzt? Wo fange ich an? Ich muss erstmal gucken, was hier überhaupt wo ist. Und überhaupt. Ich kenne das Haus noch gar nicht, habe keine Ahnung, wie es sich verhält, wo es drückt, was es will. Ich bilde mir ein, dass da mehr ist als Holz und Stein. Ein Mehr, das allen Worten entgleitet. Wenn ich jetzt sage, das hat eine Seele, so ist es das nicht. Wenn ich sage, hier Leben kleine Zwerge oder Feen, so ist es das nicht. Wer weiß das schon, was da ist. Aber irgendetwas ist da. Irgendetwas, dass das alles und die ganze Welt zusammenhält. Was Menschen am Leben hält, auch wenn es eigentlich zu Ende ist, was in Menschen eine Leidenschaft entfacht, die bis in den Tod geht und was die kleinsten Lebewesen mit den größten verbindet.
Wie eine Beziehung ist das mit diesem Haus. Und bei allem betrachtet es auch mich. Es schaut mich an mit Augen, die ich nicht sehe. Es hört mir zu. Ich glaube, es lächelt ein wenig, denn, und das muss man immerhin sagen, es wird gerettet. Eine Abrissgenehmigung haben wir später gefunden. Rattatattata, die Kettenbagger kommen, fackeln nicht lange und strecken ihre gigantischen Schaufeln dem Haus entgegen. Und dann, ein Leichtes für diese modernen Urzeitmonster, wären nach ein paar Schüben die alten Fachwerkbalken ineinander zusammen gebrochen und das Haus wäre nichts weiter als ein Haufen Holz und Steine. Gott sei Dank ist es soweit nicht gekommen.
Etwas Morbides liegt in der Luft. Das Haus ist nass, durchnässt vom kaputten Reetdach, und muffig von alten Stoffen mit Abertausend Spinnen, Millionen von Kellerasseln und allen erdenklichen Nagetieren. Auch der Garten, ein Geisterwald. Jahrzehnte ohne Pflege hat sich der Efeu in alle erdenklichen Ritzen des Hauses, der Gartenmauern und bis in die obersten Baumkronen der dunklen Tannen geschlungen. Er legt sich wie meine Gedanken über das Haus und den Wald. Gedankenstränge, lange und kurze, tiefe und flüchtige, sie kreuzen sich und sie verbinden sich. Wäschestangen ragen vergessen aus dem Boden und alte Obstbäume versuchen ihren Weg durch den Tannenwald ans Licht zu finden. Ein Märchenwald mit einem Märchenhaus.
Ein anderer Tag, wieder am Haus. Allein. Ich sammle weiter Eindrücke. Eindrucksammler. Verloren, vergessen, selbstvergessen, zeitlos, aber erfüllt in diesem Moment von allen guten Geistern dieses Planeten, streiche ich um das Haus und mit dem Schlüssel in der Hand schließlich in das Haus. Auch hier streiche ich durch die geheimnisvollen Räume, Kammern und Gänge. Eine alte knarzende Treppe führt mich ins Obergeschoss. Dort sehe ich, bei dieser einen Tür, die dieses Haus nun wirklich zu etwas fast von der Welt Entrücktem macht – denn es verhält sich so, dass man hier über eine Brücke vom Deich direkt in das erste Geschoss des Hauses gelangen kann; wo ist das schon so bei einem über 300 Jahre alten Haus? –, einen rötlichen unförmigen und recht großen Fleck. Erst als ich näher komme, entdecke ich hunderte Marienkäfer an der Wand. Ich bin ganz verzückt und betrachte diese kleinen Lebewesen, wie ich vielleicht noch nie etwas betrachtet habe. So – jetzt – wie da, war ich danach nie wieder. Ich sollte noch erfahren, was das heißt, dieses Dasein und irgendwie doch nicht so richtig Dasein.
Die bringen doch Glück, denke ich. So viel Glück kann man doch gar nicht haben. Mit dem Glück ist das ja so eine Sache. Aber ich freue mich. Und das freut mich. Kann man sich freuen, weil man sich freut? Ich habe mich jedenfalls noch sehr oft gefreut, denn die Marinis sind jedes Jahr wieder gekommen. Auch als das Haus schon lange saniert war, sollten sie wiederkommen. Denn das ist nun mal so – im Herbst kommen diese kleinen Hausbewohner und lassen sich hier nieder. Es ist ihr Platz. Ihr Platz in diesem Haus in dieser Welt. Da sind sie schon viel weiter als ich.
Wo fange ich jetzt also an? Ich denke nach, aber das ergibt gar keinen Sinn. Ich kann da nicht drüber nachdenken, denn so etwas habe ich noch nie getan. Ich habe natürlich die ein oder anderen Bücher gelesen und auch mit den ein oder anderen Freunden und Bekannten mal über was geredet. Aber jetzt, wo ich hier stehe. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mehr RTLII gucken sollen, diese ganzen bescheuerten Handwerker-ich-rette-irgendwas-Sendungen, wo dann auch gleich die ganze Familie mitgerettet wird. Tolltolltoll. Rettet mich doch auch. Aber jetzt ist es dafür zu spät.
Vielleicht aber auch nicht. Denn Knut Splett-Henning, der Guthausretter der Nation, ist mir schon öfters auf meinem Weg begegnet. Der Herr und seine Familie laufen beim NDR. Und der hat dann immer viel erzählt. Wie der sich so gefühlt hat, als er mit so etwas angefangen hat, was er geplant und was er gemacht hat. Der hat das Haus erstmal wieder in den Urzustand zurückgeführt. Alles ausräumen und alles rausreißen, was da nicht reingehört. Vielleicht kann ich so anfangen. Knut, ich danke dir. Hoffentlich.
“Ich denke, wir müssen erstmal das ganze Haus ausräumen”, sage ich, als ich mit der Familie am Abendbrottisch sitze. “Also, das ist komplett voll mit … Zeugs, oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Keine Ahnung, was das alles ist. Aber das sind Tonnen! Und das Beste ist eh nicht mehr da. So Truhen mit Intarsien, besondere Stühle oder sonstwas. Na ja, vielleicht finden wir ja doch noch was Gutes. Ich meine, aber der Rest, wo soll das alles hin? Recyclinghof? Oh Mann, das wird krass.”
“…” , Tati schweigt.
“Aber die ganzen Schränke und so. Wo sollen die denn alle hin? Die Kisten, da ist irgendwie sogar so eine alte Mangel oder so. Betonplatten, ja, das sind so gigantische Teile, ich glaube, die kann ich nicht mal alleine anheben. Keine Ahnung. Ach ja, Heu, Heu ist da auch noch überall auf dem Dachboden”, ich rede und rede und rede. Wie so oft. Und dann höre ich auf und rede immer weiter. Nur ohne Worte, in meinem Kopf. Das geht immer weiter. Eine gigantische Masse aus Ahnungslosigkeit erdrückt mich und …
Dann kommt Tati: “Vielleicht brauchen wir so einen Container. So einen Überseecontainer. Weißt du, die kosten gar nicht so viel, die kannst du im Netz bestellen, glaube ich. So einen stellen wir da einfach erstmal hin und können das vorübergehend doch als Lager benutzen.”
Tati! Ich liebe sie: “Beere, ich liebe dich!”, mein Puls beruhigt sich wieder.
“Bestellt.”
“Was?”
“Der Container”
“Wie bestellt?”
“Ich habe einen Container bestellt.”
“Du kannst doch nicht einfach…”
“Whuaaaa, haaaa, whuaaaahahahaaa!”, Mathilda meldet sich zu wort!
“Oh, du di du di duuu”, David versucht zu trösten.
“Also, du hast jetzt einfach den Container bestellt?”, frage ich wieder.
“Der Container…”
“Whaaaa haaaa whuuuaaa hah ahahahah.”
“Ja, ich habe den Container bestellt. Der kommt nächste Woche an.”
“Was?!”
“Oj Bär.”
“Nächste Woche?”
Wahnsinn. Sie bestellt den einfach. Sie bestellt mal eben einfach den Überseecontainer. Wahnsinn.
“Oke, das heißt, die nächsten Wochenenden werde ich so oft es geht zum Haus fahren und ausräumen und so weiter, ja?”, möchte ich wissen.
“Ja, und ich komme mit, soweit es geht. Die Kinder packen wir dann dick ein und dann geht das auch irgendwie.”
“Ja? Ja, ich weiß nicht, na ja, da gucken wir mal.”
“Wir haben demnächst den zweiten Termin mit dem Architekten. Dann sollten wir mal erzählen, was wir alles so mit dem Haus machen wollen, damit er sich erste Gedanken zum Plan und so weiter machen kann.”
“Oh, oh ja, richtig.”
Wenn wir uns die Bilder aus dieser Zeit angucken, können wir gar nicht glauben, wie wir das alles geschafft haben und was da auf uns zugerollt kam. Flashbacks blitzen in unseren Köpfen auf. Die Bilder, sie fangen an, wieder zu leben. Die Arbeit, die tausend Kisten, die Schränke, das Holz, der Geruch, das ganze Zeug, in diesem Haus, was raus musste, die Schmerzen, das Hin- und Hertragen, das alles ist wieder da. Ich bin wieder da.
Das geht los
Samstag 2015, Winter. Ich komme an. Tag 1. Tag 1, das weiß ich noch ganz genau, das hat sich in mein Gehirn gebrannt, das erste, das ich in diesem Haus gemacht habe. Nicht gesucht, nicht geplant, nicht gedacht – gemacht. Mit meinen Händen. Mein erster Handschlag.
Das Haus liegt vor mir, kaputt und wahrhaftig. Dieser eine Raum in der Diele, die Bretter da an der Decke, die sind so durchnässt und vermodert, die müssen da raus. Knut würde das auch so machen (ein Jahr später sollte ich noch erfahren, dass diese Arbeit – eine unter vielen – kompletter Blödsinn war, denn die Trockenbauer haben sowieso alle Wände, Decken und Räume an sich in der Diele rausgerissen). Also hole ich mein Brecheisen, ramme es in die Decke und versuche die einzelnen Bretter zu lösen. Nach drei Hieben fange ich schon an zu schwitzen.
“Was machst du den ganzen Tag in der Agentur, Isi?”
“Wie was mache ich den ganzen Tag?”, Isi.
“Na ja, beschreibe doch mal ein bisschen, was du so in deinem Job machst.”
“Klick.”
“Klick?”
“Klick. Ja. Klick. Wenn man mal drüber nachdenkt.”, Isi macht eine runde ausufernde Bewegung mit seinem Arm bis er am Ende mit dem Zeigefinger auf der Tischplatte landet. “Klick.”
“Ich verstehe nicht.”
“Klick. Ich meine, ich mache den ganzen Tag nur Klick. Ein bisschen schwurbel ich meine Maus hin und her und dann mache ich irgendwann Klick und drücke mit meinem Finger auf die Maus.”
Da war mal irgend so eine Dame vom Arbeitsamt in der Agentur, in der ich früher gearbeitet hatte. So ein Interview für irgend eine Jugendzeitschrift oder etwas in der Art. Was weiß ich. Die wusste gar nicht, was sie sagen soll. Klick. Unser Job besteht aus ein paar Klicks auf der Maus. Daran muss ich nun denken. An meinen eigentlichen Job. Klick. Da komme ich nun wirklich nie ins Schwitzen. Hier schwitze ich schon nach zwei Minuten und zwei Hieben mit dem Brecheisen. Verdammt.
Zerrissene Klamotten, Splitter in meinen Händen, Schnittwunden, Schmerzen in der Schulter, mein Gott, was bin ich doch für ein Weichei. Aber nach einigen Stunden hängt das ganze Zeug nicht mehr an der Decke, es liegt jetzt auf dem Boden. Ob das da besser ist, kann ich auch noch nicht richtig sagen. Denn da, wo die Bretter an der Decke waren, haben sich einfach nur neue, dickere aufgetan, hinter denen sich noch irgendetwas anderes auftut. Sieht aus wie Beton.

“Heute Abend kommt der Architekt. Bis dahin müssen wir uns ein bisschen was überlegt haben”, sagt Tati eines Morgens vor der Arbeit.
“Okay. Alles da”, antworte ich nüchtern.
“Wie, alles da?”
“Na, es ist doch da. Wir wissen doch, was wir wollen.”
“Ja, schon, aber vielleicht sollten wir das noch mal aufschreiben.”
“Ja… Nein. Ist im Kopf. Ich glaube, wir sprechen erstmal mit ihm und sehen dann weiter, oder?”
“Ja?”
“Ja, nicht, dass wir da jetzt uns voll die Mühe geben mit sonstwas aufschreiben, und dann ergibt das dann alles gar keinen Sinn.”
“Hm. Okay?”
“Ja, ich glaub, das ist so okay.”
Und so erzählen wir dem Architekten am Abend von unseren Ideen. Wir wohnen natürlich dort, wo auch die Bauern gewohnt hatten, im ursprünglichen Wohnteil vorne unten im Haus. Die Diele wird der Raum, wo wir das Café machen und vielleicht die ein oder andere Feier (unser größter Irrtum, wie sich noch herausstellen sollte, denn vor Feiern konnten wir uns irgendwann gar nicht mehr retten). Vorne im oberen Teil des Hauses und im Dachboden, da wo vorher das Heu und Gerätschaften gelagert wurden, sollen Ferienwohnungen entstehen.
Wir reden an diesem Abend noch lange, spinnen herum, diskutieren, träumen und bedenken. Alles ein ziemlich komplexer Prozess, der seine Zeit brauchen wird. Doch der Architekt schlägt uns vor, erste Skizzen zu machen und sich beim nächsten Mal konkret am Haus für weitere Pläne zu treffen.
Eins gibt er uns noch mit auf den Weg: Behörden. Auch das wird ein langer komplexer Prozess. Auf dem Weg bis der Bauantrag fertig ist, müssen noch viele Hürden genommen und noch viel mehr Dinge mit dem Denkmalschutzamt, dem Deichamt, dem Bezirksamt und so weiter und sofort geklärt werden. Wir haben ein bisschen Angst.
Tag 2. Aufräumen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange jetzt mal an. Ich gehe durch das Haus und suche erstmal alle Sachen zusammen, die definitiv weg können. Ausräumen. Auf den Recyclinghof. Fange ich oben an? Unten? Vornehintenrechtslinks? Keine Ahnung. Auf dem Dachboden sehe ich so viel Zeug, dass ich gleich wieder runter renne. Kalt ist das. Kalt. Schränke, Kisten, Truhen, Pappkartons, Gerätschaften, Werkzeuge, Eimer, Regale, Klamotten, Maschinen, Pakete, Strohballen, Kanister, Flaschen, Flaschen, Flaschen. Überall Flaschen. Säcke, Müllsäcke, Stoffsäcke, alle Säcke. Gerümpel so weit das Auge reicht. Eine Welt aus Gerümpel. Meine Welt, Gerümpel. Das wird dauern. Kalt. Kalt ist das.
Ich gehe an den Deich und lasse meinen Blick über die Borghorster Elbwiesen kreisen. Wie ein Greifvogel vielleicht. Aber der hat einen Plan. Ich habe keinen Plan. Der Wald, das Watt, Nebelschwaden steigen aus dem Wasser auf. Kanada, Alaska, sowas in der Art, so sieht das hier irgendwie aus. Schön ist das. Das wird vielleicht mal mein Zuhause. Doch jetzt? Wo mache ich weiter?
“Komm, Junge, geh noch mal auf den Dachboden!”, niemand da, aber ich sage es laut, um mir Mut zu machen. Der Dachboden ist vielleicht gar nicht so schlecht, schließlich muss als erstes das Dach neu gemacht werden. Da muss also alles zuerst raus.

Es war einmal ein schwarzer Ort. Der schwarze Ort. Der war so dunkel und tot, dass kein Leben dieser Welt hier lebte. Modrig, in diffuse Feuchtigkeit und stickige Luft gehüllt lag er da, der schwarze Ort. Jahre, Jahrzehnte vergingen, als auf einmal aus diesem tiefen Nichts ein kleiner Lichtstrahl den schwarzen Boden traf. Und weil kein Leben dieser Welt hier lebte, konnte sich auch kein Leben dieser Welt darüber freuen, sich darüber wundern oder es wenigstens auch nur wahrnehmen. Doch eines Tages geschah etwas ganz Fantastisches. Wenige Tage, nachdem der Lichtstrahl den Boden getroffen hatte, streckte sich ein kleines grünes und gelapptes Blatt an einem klitzekleinen zarten Stengel empor. Es war eine Eiche, die in der Dunkelheit der Dunkelheit zusprach, dass die Zeit der Dunkelheit jetzt vorbei sei und das Leben sich von nun an Bahn brechen würde. Die Eiche trägt die Hoffnung des Lebens in sich, dass zum Leben nicht mehr braucht als ein kleines bisschen Licht.
Alles Schwarz. Nur der kleine Eichensprössling steht da im Lichtstrahl des ansonsten völlig dunklen Raums – der Sprössling und offenbar eine Menge Erde drum herum. Ich nähere mich und tatsächlich, ich greife in schöne weiche Erde. Wie kann das sein? Ich folge den Lichtstrahlen erneut von oben bis auf den Boden, da sehe ich, dass die meiste Erde bei den schlechten Stellen im Dach liegt. Es muss das Reet sein, das Reet, das hier runtergefallen ist und über die Jahre wohl zu Erde zersetzt wurde. Wahnsinn. Daneben liegen überall Schalen auf dem Boden. Alle sind randvoll mit Wasser. Überbleibsel menschlichen Handelns hier auf dem Dachboden in diesem alten Haus, als die Hoffnung noch nicht gestorben war und man meinte, man könnte mit dem Auffangen des Wasser vielleicht das Haus vor dem kompletten Verfall retten. Kalt. Kalt ist das hier. Nasskalt. Ich muss die Wannen ausleeren. Die 1000 Arten von nasskalt.
“What? Wie schwer ist das denn?”, rufe ich ins leere Dunkel. Wie schwer sind diese Wannen? Außerdem verschütte ich die Hälfte des Wassers beim Versuch, die Wanne hochzuheben. Und jetzt den ganzen Weg raus aus dem Haus? Das funktioniert niemals, ich scheitere schon am Anfang bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Wie soll das bloß weitergehen?
Vielleicht mache ich erstmal Licht an. Irgendeine Steckdose bei den Treppen funktioniert, da packe ich ein Verlängerungskabel mit Bauleuchte ran. Kleine Partikel schweben und tänzeln beschwingt durch die Luft, im Gegensatz dazu das totale Chaos am Boden. Im Hintergrund erkenne ich ein paar Kanister, die ich vorsichtig mit dem Wasser der Wannen befülle, bis sie nicht mehr so voll sind. Danach trage ich alles einzeln raus und entleere sie. Wieder zurück fallen mir die Holzbalken unter den Wannen auf. Sie sind weich wie Butter. Ich kann wahrhaftig meine Finger in das Holz stecken, wie Creme. Mir wird abwechselnd heiß und kalt und meine Lungen ziehen sich zusammen. Langsam beschleicht mich ein ungutes Gefühl, was, wenn die ganze Geschichte hier nach hinten losgeht? Wenn das Haus doch so im Arsch ist, dass sich jegliche Sanierung niemals rechnen würde. Was, wenn ich gerade mein wunderschönes Leben, Haus, Familie, Job, Baum gepflanzt, gerade für ein schwarzes Loch aus Chaos, Schulden, schlaflosen Nächten und Herzinfarkt getauscht habe?
Egal.
Zu spät.
Tief einatmen.
Da sind definitiv schon mal viele alte Klamotten, die niemals mehr jemand tragen wird können. Die stinken so dermaßen nach Muff, das kann man gar nicht glauben. Kistenweise. In Schränken, in Truhen, in Kartons. Wahnsinn. Ich schmeiß alles durch die Luke runter in die Diele. Als sich genug Zeug angesammelt hat, schmeiße ich es auf den Anhänger und fahre das erste Mal von mindesten fünftausend weiteren Malen auf den Recyclinghof. Copy, paste. Das wiederhole ich noch so oft, bis der Tag rum ist.
“Was machen wir denn jetzt mit dem Wald?”, rufe ich eines Abends vom Klo. “Ist ja wohl klar, dass wir da was mit machen müssen. Baumhäuser oder so?”
“Hmm, wo bist du?”, möchte Tati wissen.
“Was?”
“Wo du bist?”
“Auf dem Klo. Wieso?”
“…”, Tati verdreht die Augen.
“Schatz?”
“Bär, bitte.”
“Was?”
“Lass mich doch bitte auf dem Klo in Ruhe.”
“Aber ich bin doch auf dem Klo!”
“Ja!”
“Also?”
“Hmm…”
“Baumhäuser?”
“Schatz, bitte lass uns…”
Dann unterbricht David: “Au ja, ein Baumhaus! Das ist ja toll, dann können wir da immer raufklettern und uns verstecken, und du kommst dann auch mit, Mama, oder?, nicht nur Papa, du auch Mama, und dann sieht uns keiner, aber wir können alle sehen… und, undundund dann…”
Jetzt unterbricht Tati: “Halt! Dein Vater kommt jetzt erstmal vom Klo runter, dann sehen wir weiter. Ja, Purzel, wir gucken mal, okay?”
“Au jaaaa!”
Kurze Zeit später im Wohnzimmer, ich so: “Also, was sagst du?”
“Also, ich weiß nicht. Das wird bestimmt nicht so einfach, wenn wir das gewerblich nutzen wollen, oder? Also, die Idee finde ich schon gut. Wir müssen halt mal gucken.”
Wie recht sie doch hatte. Wir sollten noch oft an gewerbliche Grenzen stoßen, denn schnell wurde auch nach Absprache mit dem Architekten klar, dass ein gewerblich genutztes Baumhaus derart hohe bautechnische Auflagen wird erfüllen müssen, dass wir uns ganz schnell andere Gedanken machen. Es muss eine Stufe kleiner sein.
Nach ein paar Tagen sitzen wir wieder abends zusammen.
“Auf Rügen, da haben wir doch diese kleinen dreieckigen Häuser gesehen. Andreas hat mir da auch von erzählt. Die gab es im Osten früher voll oft. Auch in Skandinavien und so. Die heißen wohl Finnhütten. Dann können wir die doch auch bauen, aber so als Waldhütten eben. Vielleicht geht das ja eher, was denkst du?”
“Ja. Ja, warum nicht. Da können wir ja mal schauen. Ich hab da gerade nicht so richtig den Kopf für. Ich habe gerade mit Andrea gesprochen, wie wir am besten firmieren. Also, auf was wir schon mal achten müssen, wenn wir irgendwann mit dem Geschäft starten wollen, weißt du?”
“Ah, und?”
“Ja, wir sind noch nicht final zu einem Schluss gekommen, aber wir sind dran. Da können wir wann anders mal drüber reden. Ich bin echt müde. Das war mit den Kindern heute so mega anstrengend. Mathilda kann ich immer noch nicht mal länger ablegen. David hat irgendwelche Streitigkeiten in der Schule und Johanna muss sich erstmal an die Situation im Kindergarten gewöhnen.”
Mit dem geplanten Umzug nach Altengamme, wie lange auch immer das noch dauern würde, haben wir aber gleich die Kinder in der Schule Altengamme angemeldet.
“Eins aber noch”, fährt Tati fort. “Ich habe da im Netz noch eine coole Sache entdeckt. Das können wir vielleicht auch im Wald machen. Die Dinger kommen aus Australien, das sind so Baumzelte.”
“Was?”, ich bin ganz verzaubert. “Was sind denn Baumzelte?”
“Das sind so Zelte, die man zwischen die Bäume spannt, mit so Spanngurten. Da schläft man dann wohl ein bisschen wie in einer Hängematte drin oder so. Das wäre doch vielleicht auch ganz gut, oder nicht?”
“Normal! Das hört sich mega an!”
“Können wir ja mal eins bestellen und testen, oder?”
“Ja, sofort.”
“Bestellt!”
“Wusste ich!”
An einem wunderschön verregneten norddeutschen Samstag treffen wir uns mit dem Architekten am Haus. Wir gehen durch die Räumlichkeiten und erfahren eine Menge Wissenswertes und Erstaunliches, das wir trotz der vielen Fachbücher über alte Häuser, die wir gelesen hatten, noch nicht wussten. Grundsätzlich hatte alles einen Sinn. Nichts war zufällig und alles war wesentlich durchdachter, als wir das von unserer modernen Warte aus vermuten würden. Die alten Fenster sind früher nicht nach innen sondern nach außen zu öffnen gewesen, damit sie bei starkem Wind nicht aufgerissen sondern an das Haus gedrückt werden, um so besser vor Wind schützen. Das Fachwerk von den alten Häusern wurde um die Fenster gebaut und nicht die Fenster an das Fachwerk angepasst. Glas war zu dieser Zeit derart wertvoll, dass sich alles andere dem unterordnete. Es gab auch keine Blendrahmen. Die Fenster wurden direkt an den stämmigen Fachwerkbalken befestigt. Auf dem Dachboden betrachten wir die Lattung auf den Sparren, die das Reet halten, etwas genauer. Wir stellen fest, dass das Reet noch mit Weidenruten an der Lattung festgemacht ist. Das kommt nur noch sehr selten vor und hatte den Zweck, dass im Falle eines Feuers die Weidenruten schnellstmöglich verbrennen, damit sich das Reet löst und vom Dach herrunterrutscht. So erhöht sich die Chance, dass das Haus nicht komplett abbrennt, sondern vorher gelöscht werden kann.
In der Abseite der Diele entdecken wir unter ein paar Holzbohlen auf dem Boden ein Loch. Später erfahren wir von Nachbarn, dass hier früher das wichtigste Hab und Gut versteckt war, um es im Falle des Krieges schnell zur Hand haben und fliehen zu können.

Auch die Zweiständerkonstruktion, das tragende Holzgerüst des Hauses, beeindruckt und gibt so manches Geheimnis preis. Die Balken dürften wesentlich älter als das Haus an sich sein. Denn an vielen Stellen gibt es Löcher, die konstruktiv keinen Sinn ergeben. Das deutet darauf hin, dass von einem anderen Haus, das abgebrannt oder sonstwie zerstört wurde, die brauchbaren Balken in unserem Haus weiterverwendet wurden.
Wir sind ganz fasziniert und beschließen, dass das doch eigentlich mal ins Fernsehen müsste. Eine gute Werbung wäre das natürlich auch. Nur wie kommt man mal eben ins Fernsehen?
Tati ruft einfach an.
“So, und jetzt ganz locker. Mich angucken, nicht in die Kamera, du musst einfach so tun, als ob du dich mit mir unterhältst. Also, du unterhältst dich ja auch mit mir.”, weist der Fernsehredakteur zwei Wochen später neben einer riesigen Kamera mich an. Tati kommt im nächsten Shot.
“Äh, ja”, stammle ich.
“Jetzt erzähl mal, was ihr hier mit dem Haus machen wollt, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid und was alles gemacht wird”, die nächste Anweisung.
Ich habe nach zwei Wörtern schon nicht mehr zugehört.
“Äh, entschuldigung, was?”
“Du machst das ganz toll.”
“Entschuldigung, ich bin da doch etwas aufgeregt.”
“Ja, ganz toll. Ist nicht schlimm. Wir schaffen das.”
Wie im Kindergarten. Ich bekomme nichts hin, und trotzdem ist alles ganz toll: “Okay, also, nochmal, soll ich erst…”
“Ja, ganz toll. Erzähl, die Kamera läuft.”
Ich habe Angst. Vor dem schönen Haus sieht man einen total verschwitzten zitternden Kerl, der stotternd versucht, ein paar sinnvolle Sätze zu formulieren. Close-Up, in einer gigantischen Nahaufnahme laufen die Schweißtropfen auf meiner Stirn langsam in meine Falten und bilden einen Strom aus Angstschweiß, der sich mein Gesicht hinunter windet und vor meinen Füßen ein Pfütze, einen See bildet. Baikalsee. Wie ich da stehe formen sich einzelne Stalagmiten, die sich irgendwann auftürmen und der Kamera die Sicht auf das Haus und mich versperren.
“Stefan, was ist eigentlich das Besondere an dem Haus?”, holt mich die Stimme aus meinem Tagtraum.
Ich reiße mich zusammen: “Es ist das einzig so verbliebene Haus in den Vier- und Marschlanden. Diese Konstruktion. Es ist ein Halbkreuz-Haus, so nennt man das. Das Besondere sind dieser Giebel hier, der zum Deich hin abknickt und die Deichbrücke, die vom Deich in das erste Geschoss führt. Früher war das ein Fluchtweg. Im Falle eines Feuers kann man über diese Deichbrücke fliehen, weil das Haus so nah am Deich steht. Also, wenn das brennende Reet den Weg zwischen Deich und Haus blockieren sollte. Das ganze Haus ist noch sehr gut erhalten.”
Ich mache eine kleine Pause.
Der Redakteur ist sofort zur Stelle: “Gut erhalten, was heißt das genau?”
“Das Fachwerk außen, das ist das eine. Kaum verbaut. Bei sehr vielen Bauernhäusern sind irgendwann massive Wände dazugekommen. Das ist hier nicht passiert. Auch die Raumaufteilung innen, die ist wie vor über 300 Jahren.”
Ich kann das gar nicht glauben, nach einer Weile verfliegt diese krasse Anspannung, ich stehe da, vor unserem Haus, hinter der Kamera und komme mir ein bisschen vor wie ein kleiner Star. Hätte mir das vor einigen Jahren noch jemand gesagt, dass ich mal im Fernsehen landen würde, ich hätte ihn ausgelacht.
Auch Tati macht ihren Job super. Wir gehen mit der Kamera und auch unserem Architekten durch das Haus und erzählen weiter, was es alles zu entdecken gibt und was wir planen.
Auch die Bergedorfer Zeitung, das Bille Wochenblatt und der Vierländer Bote berichten über die Jahre über unser Haus. Vielen Dank dafür an dieser Stelle!
Tag 3. Ich höre ganz schnell auf, zu zählen.
“Sag mal, wie willst du das alles eigentlich schaffen?”, fragt plötzlich eine Stimme aus dem Off, als ich gerade ins Haus gehen möchte.
Ich drehe mich um und sehe einen Nachbarn: “Was meinst du?”
Er stellt sich kurz vor und macht weiter: “Ich meine, wie willst du das denn jemals schaffen, das alles?”
“Das Haus?”, frage ich verwirrt.
“Das ist doch alles unendlich viel Arbeit. Das schafft man doch nie im Leben.”
“Na ja, ich mache das ja auch nicht alles alleine. Das meiste hier werden erstmal die Handwerker machen.”
“Ja, aber selbst wenn, das wird doch niemals fertig. Und überhaupt, guck dir die ganzen Balken an. Alle durch. Alles Morsch, verrottet, nass. Keine richtige Heizung, Strom, Wasser. Das ganze Zeug.”
“…”, ich bin so überrumpelt von dieser plötzlichen Entmutigung, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll.
“Ich meine, das ist ja eure Sache. Aber ich würde mir das nicht zutrauen.”
“Tja, also…”
“Wie seit ihr überhaupt darauf gekommen?”
“Das Haus? Also, wir haben diese Idee von dem Haus. Wir wollen uns hier eben was aufbauen und auch dieses Haus erhalten.”
“Das ist doch der Wahnsinn.”
“Tja. Was, soll ich sagen? Ich lebe nur ein Mal. Ich will das jetzt halt ausprobieren. ”
“Ja eben. Ich lebe auch nur ein Mal. Aber da will ich mir doch eine schöne Zeit machen! Ich möchte Freizeit und so, das Leben genießen.”
“Ja… das ist doch auch okay. Aber ich sehe das eben anders. Ein Leben, ich will da alles rausholen.”
“Der ganze Stress.”
“Wer weiß, vielleicht geht es auch nach hinten los. Aber ich hab es wenigstens probiert.”
“Also”, dann dreht er sich um und geht einfach wieder. Also. Und Hamburg sagt man Tschüs. Also. Altengamme.
Ein Mal. Ich lebe nur ein Mal. Was eine schöne Zeit ist, sollte doch hoffentlich jeder für sich selbst entscheiden dürfen.
Da liegen überall Bücher rum. Herrgott, sind das viele Bücher. Überall! Auf dem Boden in irgendwelchen Ecken, in Regalen und in Kartons. Alles voll. Das müssen Tonnen sein. Das meiste ist wohl Trash. Aber immer wieder entdecke ich auch uralte Bücher. Irgendwas aus dem Weltkrieg. Oha. Ich krame in den Kisten und plötzlich halte ich sogar ein handgeschriebenes Kriegstagebuch von Franz Voss in der Hand. Mein Herz schlägt still für einen Moment, die Zeit bleibt stehen. – Das kann mein Verstand gar nicht verarbeiten, dass da ein Kind vor fast 80 Jahren dieses Buch während des zweiten Weltkrieges geschrieben hat und ich das hier jetzt finde und lese, jetzt in diesem Moment in diesem Haus. Ein Moment im Universum, der auch die hinterste Ecke meines Geistes durchströmt und mich in eine Art ehrfürchtige Verbindung mit dem großen Ganzen setzt.
Direkt daneben, in irgendeiner anderen Kiste – Hörzu, diese Fernsehzeitschrift, hunderte Hefte, alle über sechzig Jahre alt. Mir fällt auf: Schön sind die Cover. Das Logo, ein Portraitfoto, ein paar kleine Headlines, fertig. Kein Vergleich zu den heutigen, vollgeschissenen Covern mit 1000 Teasern und noch viel mehr Headlines, Störern, Sternchen und Ausrufezeichen. Direkt unter dem Stapel Hörzu: Pin-up-Girls, Kalender-Girls, Erotik oder wie man das nennt. Girls, Girls, Girls. Kalenderblätter von einem Schrotthändler aus der Gegend, auch alle Jahrzehnte alt und in voller Haarpracht, wie das so ist.
Ganz unten finde ich ein verstaubtes Portemonnaie. Das Leder ist ganz rissig und fahl, aber irgendwas muss da noch drin sein. Ich öffne es aufgeregt und finde allerlei Passfotos und auch andere etwas größere von geschniegelten Herren in schönen Anzügen vor unserem Haus oder darin, und alle mit diesem ganz besonderen Blick, den nur Menschen aus dieser Zeit haben. Die Zeit nach dem Krieg. Versehrt, aber überlebt. Hoffnungsvoll und doch gebrochen. Das Leben lebt weiter, und man lebt es mit. Es ist skurril. Hier in diesem zerfallenen Haus, ganze Leben laufen in Sekunden und Minuten an mir vorbei. Ich blicke hinein, ich fühle mich fast schuldig, aber ich sortiere nun in ihre Vergangenheit und versuche dabei meine eigene Zukunft zu finden. Was können wir doch dankbar sein, in diesen Zeiten leben zu dürfen.
Die Bücher, Hefte und alles andere sammle ich erstmal unten im Haus im Flett in einer Ecke, wo man nicht sofort drüber fällt. Dann sehen wir weiter.
Tag 30, oder irgendwas. Ich räume immer noch. Das meiste ist und bleibt Zeug. Alles an der Schwelle zu Schrott. Gerade noch zu gut, um es wegzuschmeißen, aber auch zu scheiße, um es aufzuheben. Alte Arbeitsschuhe. Gut, interessant. Aber hebt man das auf? Ein ganzes Leben auf dem Feld oder in der Werkstatt. Aber ich habe ja noch hundert andere Paar Schuhe. Immer noch alte Bücher. Alt, aber so alt, dass sie einen Wert haben? Kleinere Möbel, Stühle, Tische. Wo soll das alles hin? Holzwurm überall. Das behandeln zu lassen, kostet viel Geld. Es gibt noch Tricks, wie man auch selber viel machen kann. Alles im Sommer ins heiße Auto legen. Oder in kalten Winternächten draußen lassen. Da sterben auch irgendwann die Würmer ab. Aber das kostet Unmengen Zeit und Kraft. Lohnt sich das? Seit Wochen und Monaten ständig diese Fragen. Ja, nein? Weg oder behalten?
Ja, nein?
Ja, nein?
Mein Gehirn platzt.
“Das macht mich ganz fertig, dieses ganze Zeug!”, murmele ich eines Abends zu Tati.
“Was meinst du?”, fragt sie.
“Diese Unmengen an Zeugs im Haus. Das kannst du echt nicht glauben!”
“Das glaub ich”
“Das ist so unglaublich viel, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich meine, wir haben das ja vorher alles gesehen. Aber so riesig ist das Haus ja gar nicht. Aber das hört überhaupt nicht mehr auf.”
“Oh Bär.”
“Diese ganzen Entscheidungen! Sind ja alles keine Weltentscheidungen oder so, aber jedes Mal musst du doch wieder nachdenken, was du damit machst. Weg, ja, nein? Aufheben? Wohin? Altes Holz, das kann ich auch nicht einfach wegschmeißen, wenn das noch gut ist. Und so. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das strengt echt an nach einer Zeit.”
“Bär.”
“Ich meine, das geht noch alles. Aber ich komme einfach echt nicht mehr richtig runter. Außerdem…”
“Oh Bär. Möchtest du lieber Steuern machen?”
“…”, ich schweige. Und schließe die Augen. Meine Mundwinkel wandern ein Stück nach hinten, und ich weiß, dass ich nichts weiß.
“Die Anträge, das wird auch alles noch verdammt viel Arbeit.”
“Ja, okay. Ich weiß. Vielleicht.”

Neben all dem können wir nach und nach einiges über die Geschichte unseres Hauses zusammentragen und entscheiden uns endlich, eine Internetseite zu unserem Haus zu erstellen. Dort laden wir Bilder vom Baufortschritt und auch folgenden Text hoch:
Das Voß’sche Haus, wie unser Haus im Dorf genannt wird, ist ein in Altengamme in den Hamburger Vier- und Marschlanden befindliches, komplett außen und innen denkmalgeschütztes Hufnerhaus mit Reetdach von 1715 direkt am Deich und dem Naturschutzgebiet Borghorster Elblandschaft. Es ist ein sogenanntes Halbkreuzhaus mit zum Deich hin abknickenden Ziergiebel und Deichbrücke – und ist in dieser Bauart das einzig verbliebene in den Vier- und Marschlanden. Dadurch ist es besonders erhaltenswert. Das Fachwerk ist fast komplett erhalten, auch der Innenraum ist nicht von größeren Umbaumaßnahmen in seiner Form verändert.
Im Osten grenzt das Grundstück direkt an die Borghorster Elbwiesen an der Elbe, im Westen liegen Pferdekoppeln und Felder. Das Haus steht mit der Traufseite zum Deich neben einem kleinen Wald, den der frühere Hausbesitzer Franz Voß seiner Zeit auf dem Grundstück angepflanzt hat.
Das Haus war, ähnlich wie das Rieck Haus, in seiner ursprünglichen Bauweise ein Rauchhaus (ohne Schornstein) mit offener Feuerstelle im Flett, das ohne Mauer direkt in die Arbeitsdiele mündete. Der Rauch zog also durch die Räumlichkeiten, konservierte so die alten Trägerbalken und Fleischwaren, die von der Decke hingen, und verließ schließlich durch die oben im Dach befindlichen Eulenlöcher das Haus. Die meiste Zeit seiner Lebensdauer wurde das Haus klassisch genutzt – die Bauernfamilie wohnte im vorderen Teil des Hauses, dem Kammerfach (Groot Döns, Lütt Döns), wogegen im Wirtschaftsteil (Flett, Diele) die Tiere lebten, Korn gedroschen und auf dem Dachboden gelagert wurde. Die Groot Döns des Wohnteils besitzt noch die alten Vertäfelungen mit Alkoven-Schiebetüren (Schrankbetten); im Flett ist die alte Holztreppe zum Obergeschoss mit Tür zum Kriechkeller der Blickfang.
Noch heute erzählen sich die Menschen des Ortes, dass es ein ganz besonderes Erlebnis war, wenn die Pferde mit dem Heuwagen in die Diele fuhren, damit die Hausbewohner und Bedienstete das Heu auf den Dachboden schaffen konnten. Dann mussten die Pferde immer durch das Wohnzimmer (früher Flett) und die kleine Tür am Deich gehen, um aus dem Haus zu kommen, da der Heuwagen die „groot Dör“ in der Diele versperrte.
In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts wurden im Wirtschaftsteil Wände in die Abseiten für kleine Räume gezogen und Fenster im Mauerwerk eingearbeitet, da die Bauern die Ausrichtung des Hauses von der klassischen Landwirtschaft hin zum Kartoffelanbau, Bäckerhandwerk in Zusammenarbeit mit der Altengammer Mühle und anderen kleineren Unternehmungen wandelten. Eine kleine Schankwirtschaft und ein Krämerladen wurde über einige Jahrzehnte außerdem betrieben – hiervon berichten uns noch heute freudig die Menschen vor Ort – und geben damit einen sehr vielfältigen Einblick in das alte Leben der Menschen. Im 2. Obergeschoss wurde eine separate Rauchkammer errichtet.
Eine alte Hauslinde, Obstbäume und der kleine Wald auf dem Grundstück geben Zeugnis von dem einst lebendigem Leben an diesem Bauernhaus.
In der Zwischenzeit macht Tati weiter mit dem Schriftkram. Kann sich kein Mensch vorstellen. Wir füllen Anträge für das Denkmalschutzamt, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Stiftung Denkmalpflege Hamburg aus. Drei Kilo Papier. In 80.000 Fragen um die Welt – zumindest um unser Haus. Das ist so viel und so kompliziert, dass wir das meiste unseren Architekten fragen müssen. Gott sei Dank zeigt er sich hilfsbereit.
“Also ich könnte mir das nicht leisten!”, sagt eine Freundin neulich beim Einkaufen.
“Wie wollt ihr das denn machen? Das kostet doch Millionen!”, fragt ein Bekannter.
“Bist du Handwerker oder wie stellst du dir das vor, wie du das alles machen willst?”, noch jemand.
Das geht immer so weiter. Alle wollen wissen, wie das alles gehen soll. Wieso, weshalb, warum. Ständig haben wir ein schlechtes Gewissen. Nein, wir sind keine Millionäre, nein, unsere Eltern oder Großeltern auch nicht. Aber deswegen beantragen wir auch Fördermittel. Deswegen sezten wir uns mit dem Denkmalschutzamt auseinander und deswegen haben wir einen Kredit bei der Bank aufgenommen. Ich sag dann immer: Man muss es schon wollen. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Ganz mittellos sollte man nicht sein. Eine gewissen Ahnung sollte man auch haben. Ein bisschen verrückt sein schadet auch nicht. Dann kann man viel erreichen – auch finanziell. Aber eins ist tatsächlich klar: Der einfachste Weg ist es nicht. Man muss es schon wollen.
Schockiert stellen wir fest, dass es bei einer der Stiftung nur einen einzigen Termin im Jahr gibt, an dem entschieden wird, wer gefördert wird und wer nicht. Mit dem Bau darf vorher nicht angefangen werden. Das heißt, wir müssen Monate warten und bekommen, wenn wir Pech haben, nur eine Absage. Das muss man als normaler Mensch erstmal verdauen. Schnell stellen wir jedoch fest, dass uns das in diesem Fall nicht sonderlich stören dürfte, da vorher weder die Architektenpläne fertig, noch die benötigten Handwerker engagiert sein dürften.
Die Handwerker – das Herzstück der ganzen Sanierung, mit ihnen steht oder fällt das ganze Projekt. Zum Glück unterstützt uns hier auch der Architekt, er soll die richtigen Handwerker finden, möglichst von vor Ort. Das geht aber auch nicht immer, denn das Denkmalschutzamt möchte teils hoch spezialisierte Firmen, die für solche alten Bauten spezialisiert sind. Teilweise passt der Zeitplan nicht und manchmal das Projekt an sich.
“Für die Wohnung können wir hier doch einfach eine Wendeltreppe hinsetzen, oder?”, frage ich, als wir uns vor Ort erneut mit dem Architekten treffen.
“Nein”, die deutliche Antwort vom Architekten.
Auch so eine Sache, die man, gerade in Deutschland, gerne mal unterschätzt – Auflagen. Da kann man nicht einfach eine Wendeltreppe bauen. Die Treppe braucht einen speziellen Winkel, dann braucht die ein Podest auf einer gewissen Höhe, erst dann kann es mit einem speziellen Winkel weitergehen. Dann braucht man da einfach dreimal so viel Platz als gedacht. Ganz zu schweigen vom Brandschutz. Was da alles an Türen, Wände, Materialien eingebaut werden muss, ist eine Kunst für sich.
Und so gehen wir also durch alle Räumlichkeiten, erzählen dem Architekten nochmals alle Pläne und gleichen sie mit der harten Realität ab.
Tag achttausenddreihundertsiebenundsiebzig. Heute nehme ich mir das Heu auf dem Dachboden vor. Der hintere Bereich ist komplett damit bedeckt, einzelne Reetbündel weiter hinten küren das Ganze. Das ist eine schöne Arbeit für einen Tag. Da kann man dann mal sagen, so, ein Tag, der Dachboden da ist jetzt frei. Check, Tagesziel erreicht. Und den nächsten Tag fahre ich dann das ganze Zeug zum Recyclinghof. Kostet dann vielleicht ein bisschen was, aber das geht dann schon. So geirrt habe ich mich selten im Leben.
In einer Abseite der Diele greife ich mir eine Heugabel und lege los. Beherzt steche ich in das Heu und schmeiße Bündel für Bündel durch die Luke nach unten. Es staubt und kratzt in der Lunge und am ganzen Körper, wie haben das die Menschen früher bloß ausgehalten? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Im Winter, das Haus ist drinnen kein Stück wärmer als draußen. Kalt, kalt, kalt. Nasskalt, das Schlimmste. Die Nässe kommt nicht von oben, sie steckt in jedem Winkel des Hauses. Sie kriecht in jedes Gelenk deines Körper, drinnen der Schweiß, draußen der Regen. Jeden Tag, alles feucht, alles klamm, das trocknet ja auch nicht. An den Fenstern sind die Eisblumen, es ist wunderschön, aber das kann man nicht genießen. Die Bauern lebten Jahrhunderte lang in diesen Zuständen, ihr Leben lang, jeder Winter bestimmt von Kälte und Feuchtigkeit. Natürlich hatten die Bauern eine Feuerstelle im Flett, auch einen Ofen, der über Nacht die gute Stube warm hielt, aber da hat man beim Arbeiten ja nichts von. Ich fühle meine kalten Finger kaum noch, meine Bewegungen werden immer langsamer und ich war noch nie so dankbar, nachher wieder nach Hause in mein warmes Wohnzimmer zu kommen zu können.
Während ich mir so meine Gedanken mache, fällt mir auf, dass das ganze Heu hier oben überhaupt nicht weniger wird. Ich stehe hier jetzt schon seit Stunden, da ist aber noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Der Heuberg auf dem Boden eine Etage tiefer ist Meter hoch.
“Vielleicht springe ich da mal runter!”, haucht mir eine innere Stimme zu. “Nein!”, die andere.
Erstmal muss ich jetzt das ganze Heu aus der Diele schaffen. Ich lege meine Heugabel an die Seite und begebe mich auf den Weg nach unten.
– knarz, krach, “Whuaaha haaaa, Aaaalter!”, da bricht unter mir eine Holzbohle weg, und ich kann mich gerade noch an einer alten Geländerstange festhalten. Eine Hüfte erscheint mir vor Augen und zwei Beine, die sich in Zeitlupe in die Hüftschalen rammen und diese komplett zerschmettern. Schreie, Panik, Krankenwagen, Krankenhaus, Op-Saal, Narkose, Schwarz. Ich freue mich, dass ich mich noch festhalten konnte. Unser Architekt hat uns genau diese Geschichte erzählt. Ein anderes Haus, ein anderer Kunde – der ist durch den Dachboden gefallen. Mit den Beinen zuerst, die wie eine Rakete schnurstracks ihr Ziel finden, ist der auf dem Boden aufgekommen und hat sich dadurch beide Seiten der Hüfte komplett zerschmettert. Gar nicht auszudenken, wie das hier hätte weitergehen soll.
Nach dem Schock muss ich erstmal eine Pause machen.
“Schatz, ich bin gerade erstmal fast den Dachboden runtergeknallt!”, spreche ich in mein Handy.
“Was?”, fragt Tati schockiert am anderen Ende.
“Keine Ahnung, die eine Bohle, die ist einfach weggebrochen. Aaaalter, ich hab so eine Angst gehabt.”
“Ja, da hat der Architekt doch von erzählt, oder?”
“Ja, genau das! Genau das wäre mir auch fast passiert. Alter!”
“Pass bloß auf, Bär! Soll ich vorbeikommen?”
“Nein, nein, ist ja alles gut gegangen. Aber das Heu kriege ich, glaube ich, nie weg. Das ist so viel. Ich bin hier seit Stunden, und der Dachboden sieht noch exakt genauso aus wie vorher. Keine Ahnung!”
“Du schaffst das schon.”
“Ja?”
“Klar!”
“Okay.”
“Mathilda hat heute übrigens ganz viel gelacht!”
“Ooooh wie schön.”
“Ja, die hat gar nicht mehr aufgehört!”
“Hmmm.”
“Schatz, hörst du?”
“Ja, jaja. Vielleicht sollte ich öfters nicht zu Hause sein…”
“Hä, warum?”
“Na ja, ich hab sie noch nicht so lachen gesehen.”
“Oh Bäääär.”
“Neinnein, Scherz. Das ist doch schön.”
“Ja. Bei dir lacht sie doch auch noch!”
“Ja. Ja, ja. Okay. Also dann, ich muss weitermachen, bis später.”
“Okay.”
“Also, tschüs.”
“Tschühüs.”
Hier unten sieht der Heuberg noch viel größer aus als von oben. Wo soll das bloß alles hin? Erstmal raus. Ich sammel alles in einer Ecke auf dem Hof. Dann geht es wieder rauf, etwas vorsichtiger bitte, und weiter. Gabel für Gabel, und schon nach kürzester Zeit ist der Berg unten wieder Meter hoch. Hier oben sieht immer noch alles aus wie am Anfang.
“Vielleicht springe ich da mal runter”, wieder die innere Stimme. “Okay”, die andere. Das ging schnell dieses Mal. Nein. Kannst du nicht bringen. Doch! Nein! Doch.
Vorsichtig gucke ich nach unten. Der Berg ragt ja nun wirklich bis fast hier oben. Kein Meter, den ich da überwinden müsste. Aber das sackt natürlich noch zusammen, wenn ich da rein springe. Meine Hände werden ganz schwitzig und ich fange an, leicht zu zittern. Adrenalin oder so. Mein Herz schlägt schneller und ich frage mich, was los ist. Eben bin ich noch fast runtergefallen und jetzt will ich freiwillig springen. Mein Atem wird flacher, egal jetzt, dann springe ich.
Eine tausendstel Sekunde später komme ich am Boden an. Experiment geglückt. Das Heu hat gehalten. Wow – seht her, hier steht der Champion der Welt. Ein Held. Wahnsinn. Mein Stolz erreicht ungeahnte Höhen. Aber keiner guckt. Keiner da, hat keiner gesehen. Verdammt. Ist es überhaupt passiert? Passiert das alles überhaupt? Wir dachten, das hier, das ganze Projekt, wird so ein großes Ding. Und jetzt bin ich seit Monaten eigentlich nur – ein Müllmann.
Weiter. Heu. Heu raus, wieder hoch, Heu runter. Der nächste Berg. Immer noch keine Veränderung hier oben zu sehen. Heu, Heu, Heu. Langsam beschleichen mich Zweifel, ob ich das hier alles jemals alleine schaffen kann. Das ganze Heu muss hier wohl über Jahrzehnte irgendwie zusammengesackt sein, komprimiert. Und ich bin jetzt das Decryption-Programm. Hätte mir das einer vorher sagen können? Also das Leben, das ganze? Vorher?
Tagelang sollte das noch so weitergehen. Tagelang, bis irgendwann nichts mehr im Haus war. Alles weg. Alles, ich auch, alle. Mein Körper ist nur noch ein Abbild von dem, was er mal war. Eine Baustelle, ein Gerüst. Ein Restmensch.
Dann ist da noch meine Arbeit in der Agentur. Mein Hauptjob – eigentlich. Doch meine Arbeitstage in der Agentur beginnen immer krasser zu werden. Die monatelange und durchgehende Arbeit am Haus zollen ihren Tribut. Ich bin nicht groß gereizt, und meine Konzentration ist auch noch soweit in Ordnung, aber die Müdigkeit ist ein ständiger Begleiter, den ich vorher so nicht kannte. Im Sommer, wenn ich in der Pause in den Bergedorfer Schlosspark gehe, schlafe ich auf einmal ein, im Sitzen, auf einer harten Parkbank. Ich nicke weg, wenn ich etwas beim Italiener esse oder wenn ich zwischendurch im Einkaufszentrum beim Buchhändler auf dem Stuhl ein Buch durchstöbere. Das ist mir völlig unbekannt. Mein ganzes Leben habe ich lange zum Einschlafen gebraucht. Jetzt schlafe ich immer und überall einfach ein. Ich stelle meinen Handywecker, lege mich auf die Parkbank und beame mich für eine halbe Stunde weg. Wie auf Knopfdruck.
“Die Leute gucken schon”, meine Träume vermischen sich mit meinen Gedanken. Wer könnte mich sehen? Sehe ich schon aus wie ein Obdachloser? Schnarche ich?
“Die Leute gucken schon.”
Was soll ich machen?
Irgendwann komme ich auf die Idee, das löchrige Reetdach zu flicken, das leckt da ja immer noch alles durch. Ich werde einfach die Reetbündel vom Dachboden nehmen, das kann ja wohl nicht so schwer sein.
Als ich eine der Leitern, die ich im Haus gefunden habe, vorsichtig gegen das Reetdach lehne, steigen erste Zweifel hoch. Ich will ja nicht mehr Schaden anrichten als Nutzen.
“Paaaapa, kannst du das überhaupt?”, fragt David, wie es nur David fragen kann. Er scheint beunruhigt.
“Klar!”, rufe ich von der Leiter zurück und werfe ihm einen Kuss zu.
“Papa, Papa, darf ich auch rauf?”, quietscht Johanna ganz verzaubert. “Bitte, bitte, bitte, bitte!”
“Schatz?”
“Johannili, das geht nicht”, versucht Tati sie zu beruhigen.
“Dochdochdoch! Wohl komme ich mit rauf. Ich kann das, Mama! Papa!”
“Johannili, warte doch bitte”, Tati wieder.
“Mamamamama, dochdochdoch!”
“Johanna, komm, wir machen das ein andermal mit einer kleineren Leiter, okay?”
“Mama, ne, ach ne! Ich will aber jetzt! Bitte…”
Ich unterbreche: “Also, bitte, ich muss jetzt mal weitermachen. Das geht los jetzt! Schatz, du gibst mir bitte immer ein Bündel an. Die Kinder können doch mal ein bisschen in den Wald.”
Vorsichtig klettere ich die Leiter weiter empor bis ich an die löchrige Stelle komme.
“Warte, ich gucke mir das erstmal an. Öhm…” Alles kreuz und quer. Es ergibt alles keinen Sinn. Ich erkenne keine Logik, keine Struktur. Was weiß ich, vielleicht haben hier ja auch schon Vögel, Marder oder sonstwas rumgewurschtelt.
“Okay, gib mir mal ein Bündel.” Ich schiebe, drücke und fummel es irgendwie in das Loch. Passt nicht. Geht nicht. Gibt’s nicht. Alles bricht ab.
“Öhm…”
“Schatz, alles gut?”, Tati muss grinsen.
“Joa.”
“Was ist denn?”
“Ja, jetzt warte doch mal. Bin ja nun kein gelernter Reetdecker oder so.”
“Ja.”
“Ja! Lachst du gerade?”
“Was?”
“Ob du lachst?”
“Ich, was? Nein!”
“Schatz, das ist nicht witzig! Alter, ich will unser Haus hier retten! Du kannst doch jetzt nicht einfach rumlachen oder so!”
“Schatz!”
“Ne, echt!, das ist jawohl ein Witz!”
“Nein!”
“Alter!”
Nachdem ich mich beruhigt habe, versuche ich es mit einem weiteren Bündel erneut. Diesmal probiere ich eine andere Technik. Ich versuche das von unten nach oben reinzustopfen. Ich drücke und quetsche und drücke wieder.
“Argh!”, schreie ich plötzlich.
“Schatz?”
“Ja!”
“Alles gut?”
“Fuck!”, das Blut strömt mir aus dem Finger. “Fuck, ganz schön scharf, das Zeug. Schatz, schmeiß mir mal ein Taschentuch hoch.” Beim Reinstopfen bin ich abgerutscht und habe mir einen Reethalm in den Finger gehauen.
“Warte … hier.”
“Danke.”
Ich fummel mir das Taschentuch irgendwie um den Finger. Hält nicht besonders gut. “Hast du mal Klebeband?”
“Was?”
“Klebeband?”
“Du kannst das doch nicht mit Klebeband da festbinden!”
“Schatz, bitte, hast du was?”
“Nein!”
Scheiße.
Doch das Reet schein jetzt etwas besser zu halten.
“Schatz, jetzt die anderen Bündel!”, rufe ich.
“Ja! Und deine Wunde?”
“Geht schon.”
“Ja?”
“Ja! Ich hab da irgendwie so einen Knoten reingefummelt.”
Nach einiger Zeit habe ich rund ein Dutzend Reetbündel an verschiedenen Stellen ins Dach gestopft und bin sehr stolz auf mich.
Am nächsten Tag regnet es – bin ich gespannt! Am Haus angekommen renne ich sofort hoch auf den Dachboden, um meine Handwerkskunst im Reet zu bewundern. Doch ich stehe im Regen. Das hat dann ja einfach mal gar nichts gebracht. Gut gemeint ist nicht gut gemacht, vom Regen in die Traufe und so. Weiter.
“Das ist ja wie der alte Kotten in Brockhausen, in dem wir gelebt hatten”, strahlt Tatis Oma Johanna, als sie vorsichtig das Haus durch das große Tor betritt.
Wir haben tatsächlich geschafft, dass Tatis Großeltern sich das Haus einmal anschauen können. Sie kommen von weit, weit weg und sind nicht mehr die jüngsten. Opa Willi und Oma Johanna sind die einzigen Menschen, die uns nicht von Anfang an entmutigt haben, die uns nicht alles ausreden wollten, die einzigen, die uns sagten, dass wir das schon schaffen würden, die einzigen die an uns geglaubt haben; was sie vielleicht bei sich dachten, wissen wir nicht. Aber es tat so gut, dass da wer ist, der uns Mut gemacht hat.
“Ja, ja, so in etwa war das auch bei unserem Kotten, das stimmt”, stellt auch der Opa fest. “Vielleicht ein bisschen anders. Ja, so, vielleicht … das ist schon noch viel Arbeit, und dass…”
“Willi!”, unterbricht die Oma.
“Ja, Hannchen, das muss man doch mal sagen dürfen.”
“Ja, Willi, lass gut sein. Das ist doch jetzt nicht so wichtig.”
“Ach, Hannchen. Das ist doch offensichtlich.”
“Willi!”
Dann übernimmt Tati die Führung: “So schön, dass ihr da seid, kommt ich zeig euch alles.”
Tatis Großeltern necken sich ein wenig, das gehört dazu. Sie haben sogar schon die goldene Hochzeit hinter sich und halten immer noch zusammen.
So streifen wir durch das Haus, und Willi und Johanna fühlen sich, als ob sie schon einmal hier gewesen wären. Sie streifen durch ihren Kotten in Niedersachsen, eine unverhoffte Zeitreise. Eine Zeitkapsel, ein Stückchen Erlebtes und Gelebtes, dass dieses Haus erweckt, ein Stückchen, dass nur Häuser mit Geschichte erwecken können.
Das geht weiter
Die Bibel. Das ist ein Werk sondergleichen. Dick wie ein Staatsarchiv, kann sich kein Mensch vorstellen. Dreimillionen Seiten. Mehrere Bände.
Nachdem wir uns noch viele Male am, im, unter und mehr oder weniger auch über dem Haus mit dem Architekten getroffen und alles durchgesprochen haben, ist nun der Bauantrag fertig. Wir können den Umfang des Werks bis heute nicht glauben. Allein die Statik und der Brandschutz könnten eine eigene Dissertation sein – die Relativitätstheorie, Malen nach Zahlen dagegen.
“So, jetzt nur noch unterschreiben”, grinst der Architekt sichtlich amüsiert.
Erst verstehen wir nicht, warum er grinst, dann verstehen wir ganz schnell. Keine einfache Unterschrift am Ende des Vertrags. Nein, dutzende, hunderte Male, fast jede Seite braucht unsere Unterschrift, weil irgendwas auf fast jeder Seite irgendwie noch mal gesondert abgesegnet werden muss, und so weiter und sofort. St. Timmann, T. Timmann. Die ersten Male sind ganz leicht. Danach wird es schwieriger, denn die Schrift ändert sich leicht von Mal zu Mal. Und während man so schreibt, denkt man jedes Mal darüber nach, wie man so schreibt. Gilt die achtzehnte Unterschrift überhaupt noch? Hat sie den gleichen Wert wie die erste, obwohl sie doch schon ganz anders aussieht? Wir haben Angst. So viele Unterschriften, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Ich beruhige mich mit Szenen aus Film und Fernsehen. Präsidenten, Banker oder CEOs von gigantischen Tech-Unternehmen, da kommt doch auch immer irgend so ein Berater, der denen so einen Vertrag hinlegt, der dann auch einfach ohne große Recherche oder Bedenken unterschrieben wird. Trump, Putin, Armando, zack, unterschrieben. Bei unserem Bankvertrag hatten sich doch auch alle gewundert, warum wir alles so genau wissen wollen. Wird schon gut gehen.
Auch alle denkmal-, deich- und sonstigen rechtlichen Belange sind geklärt. Jetzt kann er abgeschickt werden, und es wird richtig spannend.
Eines Nachts wache ich schweißgebadet auf. Alles schwarz. Meine Blicke suchen etwas, an das sie sich festhalten können. Das Straßenlicht hinter der Kastanie, das ich aus dem Fenster sehen kann. Schön ist das. Was machen wir hier eigentlich? Wir machen das wirklich, wir haben unser Haus verkauft, unser neues, fertiges Haus und wollen in diesem Schrotthaus leben. Das alles, geht das gut? Reicht das Geld, das ist so unfassbar viel Geld. Ich hatte Blut im Urin.
“Schuster, bleib bei deine Leisten!”, geistert mir durch den Kopf. Ich muss an meine ersten kläglichen Bewerbungsversuche für einen vernünftigen Job in der Werbung denken. Ich so, voll kreativ, will so richtig zeigen, wie geil ich bin, wie das so in der Werbung ist, schreibe auf die Titel- und Kapitelseiten meiner Bewerbung, die ich mit diversen Grafiken aufpimpen will, so schlaue Sprüche drauf. Geht aber voll nach hinten los. Nur Absagen und die besonders harte Absage von einem Freund von einem Freund, bei dem ich mir besonders viel Hoffnung gemacht hatte. Macht mich richtig kaputt. Richtig fertig, wie ich so dämlich sein könnte, einem erfahrenen Werber die Welt erklären zu wollen. Und so.
“Schuster, bleib bei deinen Leisten.”, in dem Moment bekomme ich eine derartige Angst, dass ich Tati wecken möchte. Doch, nein, lieber nicht, reicht wenn ich Panik habe. Sie macht so schon so viel mit den ganzen Anträgen und so. Und Mathilda ist noch ein Baby. Ein Wahnsinn, wie sie das macht!
Ein Teil davon
Tag Einemillion.
“Stefan, hier, hast du die alte Mangel schon gesehen?”, ruft mir mein Vater am Wochenende entgegen. Wieder Dachboden. Wieder, immer noch, immer.
“Was?”
“Die Mangel hier? Ist die schwer! Die muss ja auch irgendwie runter hier.”
“Warte, ich komme.”
Ein gusseisernes Monster von einer Mangel steht mitten im ansonsten schon recht frei geräumten Dachboden. Ich hebe sie leicht an und stelle fest, was mein Vater auch schon festgestellt hat: Ist die schwer!
“Vielleicht bauen wir eine Rampe.”, ruft er.
“…”, ?
“Wir suchen uns ein paar stabile Bohlen zusammen und die legen wir über die Treppe und lassen die da vorsichtig runterrollen.”
“Oha.”
“Ja, hast du eine bessere Idee?”
Ich hebe die Mangel erneut an: “Nein.”
Also suchen wir uns von irgendwo her ein paar fette Holzbohlen und bauen die Rampe. Es ist alles sehr eng im Flur, weshalb sich die ganze Situation als sehr steil darstellt. Vorsichtig rollen wir die Mangel auf die Rampe, einer vorne, einer hinten, und versuchen sie nun herunterzurollen. Ganz langsam aber sicher wird sie immer schneller.
“Hallo, hallohallo!”, schreie ich und stemme mich mit meinem ganzen Gewicht gegen die Mangel.
“Jaja!”, erwidert mein Vater und zieht von der anderen Seite so doll er kann.
“Hey, ich kann die nicht mehr halten!”
“Ich halte ja!”
“Neee!”, nützt alles nicht, ich springe zur Seite und die Mangel rammt mit der Wucht eine Kleinwagens gegen die Wand am unteren Treppenrand.
“Bist du in Ordnung?”, ruft mein Vater.
“Ja. Jaja, oh Mann, Scheiße, das kann doch nicht wahr sein, ist die schwer.”
“Ja.”
“Bei dir auch alles okay?”
“Ja, jaja. Ist doch alles heil geblieben, oder?”
“Ja.”
Jetzt steht sie da, ein paar Meter weiter unten. Eine Stunde für ein paar Meter. Schwertransport. RTLII, wo bist du, wenn man dich braucht?
Während sich mein Vater nun den Kindern widmet, die unten schon den halben Tag mit Tati rumspielen, wühle ich mich durch die letzten verbliebenen Kisten auf dem Dachboden. Was ich finden sollte, fasziniert mich bis heute.
Es war einmal ein Wald, der hatte ganz besondere Bewohner. Manche waren groß und manche waren klein. Manche waren dick und manche waren dünn. Manche hatten ganz viele Blätter und andere etwas weniger, die waren aber viel viel größer. Manche von ihnen hatten Nadeln an ihren Ästen, die gestochen haben. Andere Nadeln waren ganz weich. Manche hatten eine ganz glatte Rinde und andere waren so tief zerfurcht, dass sich kleine Tiere darin verstecken konnten. Es waren so viele Bewohner, dass ich sie nicht zählen konnte.
Da waren Eichen und Buchen und Eschen und Erlen, da, wo es etwas feuchter war. Und Bergahorn, Feldahorn, Ginko sogar. Da waren auch Tannen und Fichten, Douglasien und auch die schweren Eiben. Da waren Kiefern in allen Größen und Arten, da, wo es etwas trockener war. Da waren Thujas, Zypressen und Mammutbäume. Felsenbirnen, Flieder, Weißdorn. Und der Holunder, der Hüter der Tiefe, der sich gerne zu den großen unter den Bäumen gesellt.
Die seltene Elsbeere war zugegen, Traubenkirschen, die kaum einer gesehen hat und mächtige Waldkirschen, die es früher viel öfters gab.
Die Welt der Eschen, die war an den Lichtungen und einzelnen Wegen, zusammen mit altem Ahorn und alten Eichen. Und die Welt der Tannen, die war die dunkle Welt, der schwarze Wald mit den Lebensbäumen, die standen dicht an dicht. Die lichte Welt der Kiefern, die noch viel dunklere Welt der Fichten.
Der Duft der vielen Nadelbäume, ein jeder ein anderer, manche dufteten nach harziger Erde, andere nach satten Zitronen, wieder andere nach süßlichen Kräutern, benebelte die Sinne – wer könnte einen Nadelbaum einen Laubbaum als nicht ebenbürtig ansehen?
Alte Bänke, Wegmarkierungen, Zauberbrunnen und Feenteiche, Baumkreise und Feenringe.
Es heißt, der Wald sei von einem freundlichen alten Mann in einem alten Haus erschaffen worden. Ein Wald und seine Bewohner. Ein Wald für seine Bewohner, und für seine Gäste. Denn der alte Mann wollte seine Freunde einladen, Teil des Waldes zu sein. Sich niederzulassen und das Waldleben zu leben, das es zu leben gab.
Doch der alte Mann konnte und durfte nicht, so, wie er wollte, und so zerbrach sein Herz, eines Tages, und er starb vor den Toren seines Waldes.
Der Wald lebt bis heute weiter, und ein Teil der Seele des alten Mannes auch. Am Ende, wenn sich alles mit allem verbindet, findet die Seele Ruhe und Frieden.
Persönliche Unterlagen, Fotos, Dokumente, Briefe, Postkarten, Bilder vom Haus, von seinen Bewohnern, dem kleinen Tante Emma Laden und Zeitungsartikel. So vieles, das auch in den letzten Kisten noch steckt. Doch ein Zeitungsartikel beschäftigt mich besonders: ein Zeitungsartikel über eine von einem der vorigen Besitzer des Hauses geplante Kleingartenkolonie im Wald des Elbvorlands. Da war offensichtlich schon viel passiert, viel angelegt und viel in die Wege geleitet. Doch dann kam es zu Streitigkeiten mit dem Amt, und alles musste gestoppt werden. Ich frage mich, ob wir vielleicht mit unserem Projekt einen kleinen Teil dieses Traums weiterführen. Ob wir vielleicht ganz gut hierher passen.
Ein schöner Gedanke.
Ich mache weiter. Unter einem Stapel Zeitungen schaut die Ecke eines Bilderrahmens hervor. Ich packe die Zeitungen beiseite und entdecke ein großes Gemälde von unserem Haus. Spalierlinden und blühenden Obstbäume säumen das Haus und lassen es in eine Art Dornröschenschlaf fallen, es scheint sich schüchtern hinter dem Deich zu verstecken und weiß doch genau um seine Schönheit. Das scheint auch Hans Förster fasziniert zu haben, denn der hat es gemalt und signiert. Ein echter Hans Förster (das sollte uns später auch das Altonaer Museum bestätigen). Er gilt als der bekannteste Maler der Vierlanden. Das macht uns dann ja doch ein bisschen stolz.
Weiter hinten liegt noch eine Kiste, eine Holzkiste. Als ich sie zu mir ziehen möchte, kann ich nicht glauben, wie schwer sie ist. Muss denn früher alles immer so schwer gewesen sein? Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht weitermachen. Das ist alles so viel, und es hört auch einfach nicht auf. Für den Bruchteil einer Sekunde denke ich, dass ich die Kiste einfach durch die Luke nach unten schmeiße, sie zerschmettert auf dem Boden, und, mir ist egal, was da drin ist, alles geht kaputt, und ich freue mich, dass ich einfach mal etwas nicht ausgeräumt, sondern einfach weggeschmissen habe. Aber nein, das bringe ich dann doch nicht übers Herz und öffne sie etwas lustlos. In der Holzkiste sind weitere Holzkisten. Kiste für Kiste hole ich aus der Kiste und öffne nun die erste Kiste. Da sind kleine Glasplatten drin, Glasplatten in kleinen Papiertüten. Pergament vielleicht? Soll das ein Witz sein? Vorsichtig ziehe ich eine heraus. Was ich dann sehe, habe ich so vorher noch nie gesehen. Das sind Negative. Bilder. Fotos. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so etwas früher gab. Aber es scheinen Hunderte alter Bilder vom Haus, seiner Umgebung, seiner Menschen und seiner Bräuche zu sein. Eins beeindruckt mich besonders, es ist gleichzeitig die größte Glasplatte – unser Haus von der Vorderseite im Garten fotografiert, im Winter. Ein Tannenbaum im Vordergrund und der Schnee so hoch wie in den Bergen. Wie schön das ist.
Wieder werde ich Beobachter dieser über Generationen währenden Geschichte der Familie dieses Hauses. Man fühlt sich ertappt, so als ob man das doch nicht einfach alles angucken darf, man ist ja kein Teil davon. Und doch ist man nun zwangsläufig ein Teil davon. Man gehört nicht dazu, und doch ist man nun verbunden mit einer einst völlig fremden Familie. Jetzt ist sie einem nicht mehr fremd, und doch kennt man keinen einzigen Menschen persönlich.
Es war einmal eine alte stille Frau. Die stille Frau. Die tauchte auf und verschwand, ganz wie es ihr gefiel. Geistgleich und stets mit einem wuscheligen Hund schwebte sie zu allen und zu keinen Zeiten über den Deich an unserem Haus vorbei. Wenn sie im Nebel, oder auch bei Sonnenschein, aber meist im Regen, einen anderen Menschen am Deich sah, so war es ihr Bestreben, unauffällig die Straßenseite zu wechseln. Was ihr natürlich nicht immer gelang. Und sollte es geschehen, dass sie sich einem Menschen am Deich näherte, so schaute sie einen an und nickte ganz leicht. Und jeder, der in ihre Augen sah, sah diese Traurigkeit von unendlicher Tiefe. Und jeder, der je in ihre Augen sah, ward im Leben nie wieder ganz so glücklich wie zuvor.
Das geht Tage, Wochen, Monate. Mein Leben, im wahrsten Sinne ein Trümmerhaufen. Es besteht nur noch aus Räumen, Schleppen, wegschmeißen, wegbringen und von vorne anfangen.
In Zeitlupe setze ich einen Fuß vor den anderen. Der kalte Matsch auf dem Boden zieht mir in die Knochen. Ich trage einen vierzig Kilo schweren Holzbalken auf den Schultern und versuche nicht zusammenzubrechen. Körperspannung halten, ganz langsam, wird schon gutgehen. Doch beim nächsten Schritt rutsche ich auf einem im Schnodder untergetauchten Ast aus. Mit letzter Kraft stemme ich den Holzbalken von mir weg und falle mit meinem Gesäß klumpenartig zu Boden. Einen Augenblick später erschüttert der Holzbalken, der direkt neben mir aufschlägt, die Welt, meine Welt, mein Gehirn, meinen Verstand, meine Kraft. Alles. Ich bleibe liegen. So dermaßen nicht mehr konnte ich noch nie in meinem Leben. Der Geist meiner Seele steigt als leicht schimmerndes Lichtwesen empor und schaut mit einem milden Lächeln, das mir sagen will, ach komm, gibt Schlimmeres, auf mich herab. Ich bleibe liegen. Die Schmerzen sind dumpf, ich sehe mich wieder von oben. Splitscreen, Close-Up auf der einen, Vogelperspektive auf der anderen Seite. Mein Gesicht, schmerzverzerrt und dieser Blick, den wir noch oft haben werden – Augen geschlossen, Lippen zusammengepresst und die Mundwinkel nach hinten gezogen. Es kann nicht wahr sein, das alles. Ich bleibe liegen. Erste Verwesungsspuren sind zu sehen. Es stinkt. Am Deich gehen die Menschen auf und ab. Ab und zu guckt einer runter. Aber keiner schaut nach dem Mann, der da liegt. Ich bleibe liegen. Tage, Wochen, Monate, Jahre, ich bin schon gar nicht mehr da. Keiner hilft. Und wenn alle es sehen würden. Keiner käme. Jetzt, in diesem Moment, bin ich der einzige Mensch auf der gesamten Welt. Universum. Ich bin alleine. Ich könnte schreien, ich könnte heulen, ich könnte. Traurig. Aber leider wahr.
Der Winter bleibt. Immer noch. Immer wieder. Hört nicht mehr auf. Durchnässt. Durchgefroren. Durchhängen. Als ich mich nach dem Sturz mit dem Holzbalken wieder aufraffe, muss ich an Harry Potter denken. Der hatte ja auch kein leichtes Leben. Sonst hätte man über den ja gar keine Bücher geschrieben. Filme und so ja auch noch. Also weitermachen. Schwäche ist ein schlechter Berater. Harry, steh mir bei. Gibt es den überhaupt?
Sommer. Oder so. Alles ein Brei. Aber der Dachboden ist so gut wie geschafft. So gut immerhin, dass sich die Handwerker, die irgendwann kommen werden, ans Dach machen können. Also geht es eine Etage tiefer. Hier stellt sich die ganze Situation als etwas diffiziler dar. Wo oben nur Zeug war, ist hier unten auch Giftzeug. Also millionen Gläser, Flaschen, Eimer, Kübel, Kanister mit den skurrilsten Namen drauf. Säure ist auch dabei. Hochprozentige Salzsäure. So Zeug. Gift. Das wird ja lustig auf dem Recycling-Hof. Aber es nützt ja nichts. Also suche ich alles zusammen und verstaue es auf meinem Anhänger.
“Ein Atompilz von der Größe einer Kleinstadt ragte in den morgendlichen Himmel der Vier- und Marschlande, einer bäuerlich geprägten Region im Südosten Hamburgs, und zerstörte weite Teile Norddeutschlands, sogar Regionen in Dänemark wurden von der Explosion in Mitleidenschaft gezogen. Nur Dank Elon Musks Erfindung einer intergalaktischen Zeitmaschine konnte das Unglück rückgängig gemacht und der Fahrer vom Transport dieser brisanten Anhängerladung abgehalten werden.”, so oder so ähnlich würde es in der Tagesschau kommen.
“Ha!, was ist das denn für ein Fachlabor?!”, schreit mich ein Mitarbeiter des Recyclinghofes an, als ich mit dem Auto vorgefahren komme.
“Ja. Ja, haha. Ich weiß auch nicht”, stottere ich.
“Macht ja nix, wir haben ja die Experten. Fahr mal durch. Um die Ecke, Bereich C bei Container 15, beim rechten Tisch, da ist noch ein Kollege, oh, Verzeihung, KollegIN natürlich, die kann ihnen da weiterhelfen. Erstmal alles auf den Tisch legen. Da auf den Edelstahltisch. Nicht den daneben aus Holz. Das ätzt dann ja sonst alles durch, wenn da was lecken sollte. Alles klar, dann man tau.”
“…”, ich schweige.
“Sonst noch was?”
“Nein. Danke”, was hat er gesagt? Wo ist das? Na ja, ich fahre erstmal langsam ums Eck und parke irgendwo möglichst unauffällig. Die erste Kiste nehme ich gleich mit.
“Hier lang!”, ruft eine freundliche Stimme aus dem Off.
“Waswo?”, ich stelle meine Kiste ab.
“Hier!”, die Dame winkt mir entgegen und präsentiert den Edelstahltisch.
“Ah.”
Kiste für Kiste hole ich herbei und stelle vorsichtig ein Giftzeug neben das nächste auf den Edelstahltisch. Nach wenigen Minuten ist der Tisch gefüllt.
“Na, sag mal, was ist denn da los? Ne Laborauflösung, oder was?”, ein anderer Mitarbeiter kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
“Ja. Jaja.”
“Muss ich mir Sorgen machen?”
“Nee.”, ich sehe vor meinem inneren Auge wieder den Atompilz. “Jetzt seid ihr ja da.”
“Na ja, dann hamma ja endlich ma wieder was zu tun!”
“Ja. Ja.”
Ein so eine Sache bleibt mir auch lange im Gedächtnis. Wenn du schon lange lange nicht mehr kannst, kommt es so richtig. Mein Vater ist da, Björn, ein damals eigentlich nur recht flüchtig Bekannter und ich. Und diese bestimmt ein Dutzend dieser Stahlbeton-Deckenelement-Dinger. Das darf nicht wahr sein. Wie kann etwas so schwer sein? Oben in drei Meter Höhe auf diesen Abseiten in der Diele liegen sie. Drei Millionen Tonnen, eine. Mindestens. Ich klettere die Leiter hoch, krabbel in diese Nische und kralle meine Hände tief in die Furchen dieser Betonmonster. Kein Millimeter. Keinen einzigen Millimeter bewegt sich dieses Ding. Jetzt kommt auch mein Vater. Zusammen schaffen wir es, bei jedem Ruck, das Monster ein paar Zentimeter Richtung Kante zu stemmen.
“Baum fällt!”, schreie ich und gebe einen letzten Ruck.
Das Monster fällt zu Boden und – es donnert. Aber das Ding ist so schwer und stabil, dass es einfach nur liegen bleibt. Nichts zerberstet, nichts entzweit und nichts zersplittert. Wie ein Magnet zieht der Boden das Monster an sich, zu schwer, zu viel Schwerkraft, das ist wie angeklebt. Kann sich kein Mensch vorstellen.
“So, dann man zu, das Ding muss raus”, bemerkt Björn völlig unbeeindruckt. Der Mann ist bei der Feuerwehr, ich denke, er hat schon ganz andere Sachen erlebt.
Mein Papa und ich klettern wieder runter und betrachten das Ding wie ein Raumschiff. Außerirdisch. Das Ding aus einer anderen Dimension.
“So, ihr zwei vorne, ich hinten!”, kommandiert Björn.
“Öhm…”, ich zögere etwas.
“Und…”, Björn setzt schon an.
“Halt! Warte mal, das können wir doch jetzt nicht einfach raustragen. Also, du da alleine da hinten, das geht doch nicht. Nicht, dass du dir sonstwas brichst!”, ich versuche ihn zu bremsen.
“Ach was, Jungs, nun kommt.”
“Ich hole die Sackkarre!”, kontert mein Vater.
“Ja, das ist gut!”, rufe ich.
“Jungs! Kommt, ich hab nicht ewig Zeit!”, wieder Björn.
“Aber, aberaber…”, ich habe Angst.
“Und!”, Björn schafft Tatsachen.
Tatsächlich, das Wunder geschieht. Nach einer guten halben Minute liegt das Ding vor dem Dielentor. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber das weiß ich ja öfters nicht. Mein Leben.
Nach einigen Stunden stapeln sich die Dinger am Deich. Sie sehen aus wie ein kleines Stück Architektur von Le Corbusier und prangern meine Gedanken an – was hast du dir hier für eine ganz große Scheiße ausgesucht? Seit fast einem dreiviertel Jahr verbringst du jede freie Minute auf diesem Schrotthaufen / Haus. Was hast du dir dabei nur gedacht?
Da waren noch viel mehr Sachen, die alle raus mussten. Aber für den Moment reicht das vielleicht.
“Schatz, der Bauantrag ist durch!” ruft Tati morgens aus der Küche.
“Was?”, ich verstehe sie nicht, ich mache mich gerade für die Arbeit fertig.
“Der Bauantrag, komm her!”
In Unterhose tauche ich in der Küche auf.
“Papa!”, ruft David.
“Iiiiiiiii!”, quietscht Johanna.
Mathilda blubbert auf der Decke auf dem Boden etwas vor sich hin.
“Was ist?”, frage ich.
“Der Bauantrag ist durch!”
“…”, …
Wir fallen uns in die Arme, schließen die Augen und grinsen über beide Ohren.
“Sie haben unsere eine Millionen Unterschriften wohl akzeptiert”, flüstere ich.
Tati lacht.