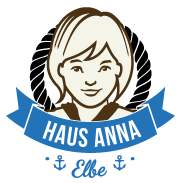Das Gerade ins Schräge / Waldhütten & Robinienstämme
Buch: Kapitel 05
2016. Der Brief ist da. Wir sind gespannt, wie ein Flitzebogen.
“Sehr geehrte Frau Timmann, sehr geehrter Herr Timmann…”, so und so, und so und so, wir lesen schnell weiter bis wir es entdecken – unser Antrag wurde genehmigt, und wir erhalten die erhoffte Fördersumme!
Einige Wochen später steigen auch noch eine andere Stiftung und das Denkmalschutzamt mit ein. Wir sind im siebten Himmel und freuen uns nicht nur über das Geld, sondern auch darüber, dass die ganze Arbeit mit den Anträgen nicht umsonst war.
Es kann losgehen.
Als die ersten Handwerker kommen, fühlen wir uns wie Weihnachten. Geschenke auspacken, das Haus wird in neuem Glanz erstrahlen. Weihnachten auf Sparflamme, denn so sehr wir uns freuen, dass die Handwerker kommen, so sehr sind wir auch frustriert, dass wir nicht immer da sind, wenn die Handwerker da sind. Tati hat die drei Kinder und später wieder einen 20-Stunden-Job. Ich bin vollzeit in der Agentur. Die Überschneidungen, an denen Tati oder ich da sind, wenn die Handwerker da sind, sind sehr gering.
Dafür sind Architekt und Bauleiter da. Trotzdem ist es zu skurril, dass so viel passiert ist, wenn man abends nach der Arbeit vorbei schaut.
Bauzufahrt, Gerüst, Reet runter, Dachstuhl neu, Gauben neu, Reet rauf, Mauern raus, Balken raus, Balken rein, Mauern rein, Boden raus, Boden auf, Sand raus, neue Ständer, neue Fundamente, Beton rein, Dachboden neu, Stahlträger rein, Holzbohlen rauf, Beton rauf, Fenster rein, Türen rein, Innenarbeiten, Mauern, Böden, Strom, Wasser, Heizung, Sanitär, Fliesen, Malerarbeiten, fehlt noch was?
Von vorne:
Das Dach und das Amt, oder wie man ganz schnell 3.000 Euro verliert
Als erstes muss das Dach gemacht werden, damit es nicht mehr reinregnen kann. Das wichtigste bei jedem Haus. Ganz oben, wie beim Menschen. Wenn oben was nicht stimmt, kann der Rest auch nicht ganz dicht sein.
Doch bevor überhaupt irgendetwas beginnen kann, muss eine Bauzufahrt eingerichtet werden. Das Haus steht sehr eng am Deich, der Stegel, also die kleine Zufahrt zu unserem Hof ist zu eng und zu steil – kein LKW der Welt würde hier runterkommen. Auch unten am Haus ist zu wenig Platz. Früher war der Hof größer, auch andere Gebäude waren noch Teil davon. Doch dann, wie das leider oft so ist, wurde wegen Erben und so weiter und sofort der Hof getrennt. Alles nicht so einfach.
Also rollen die Muldenkipper an und kippen Kubikmeter für Kubikmeter Mineralgemisch, eine Art fest werdendes Erdschüttsandkiesgedöns, ab. Anschließend wurde noch alles fest gerüttelt, damit bloß die schweren Fahrzeuge, die kommen werden, nicht wegrutschen oder sich festfahren können. David und Johanna sind von den brutalen Gerätschaften, die da jetzt vor unserem fragilen Haus agieren, ganz begeistert. Mathilda ist alles egal. Ich stelle mir vor, wie einer der Bagger den Halt verliert und in unser Haus kracht und wir wie angewurzelt davor stehen und uns fragen, warum wir jemals aus dem Bett aufgestanden sind. Bett? – Gebärmutter. Warum sind wir da jemals raus? Alles umsonst. Bagger, Haus, kaputt. Ich wache auf und stelle fest, dass das nicht so ist. Glück gehabt.

Die nächsten Tage kommt das Baugerüst. Hier und da und dies und das, wir waren beim Aufstellen leider nicht dabei. Sieht aber alles verdammt gut aus. Wäre auch alles kein großes Problem gewesen, hätten wir nicht irgendwann einen Brief von der Stadt bekommen, mit dem sie uns auffordert, einfach mal über 3.000 Euro an sie für die Nutzung des Deichs zu zahlen. Wir fallen aus allen Wolken und begreifen gar nicht, was da los ist. Wir lesen den Brief erneut. Es geht darum, dass das Gerüst ungefähr einen Meter auf städtischem Grund steht. Also nicht auf unserem Grundstück. Weil, das geht ja gar nicht. Sobald ich aus der Haustür komme, stehe ich auf städtischem Gebiet, weil das Haus so nah im Deich steht.
Sofort rufen wir das Denkmalschutzamt an, denn wir und sie verstehen sofort: Wir erhalten Förderungen, die doch bitte ins Haus fließen sollen und nicht in die Nutzung des Deichs, nur weil da für ein paar Wochen ein Gerüst drauf steht. Das tut ja auch niemandem was. Keiner muss einen Umweg fahren, es kann auf niemanden etwas herunterfallen, weil keiner drunter durchgehen muss oder kann. Das geht auch gar nicht anders. Das kann nur da stehen. Wenn wir das Haus also retten wollen, geht das nur so. Ist dem Amt aber egal. Wir müssen das Geld zahlen. Ich suche nach einem Ausweg.
Wir beauftragen einfach eine Spezialfirma, die das Haus im ganzen ein paar Meter versetzt. Unter dem Haus wird der Boden abgetragen, das Haus wird also unterhöhlt – gibt es das Wort? –, mit Stahlträgern gesichert und dann auf eigens für diesen Zweck aufgestellten Schienen verschoben. Das ganze kostet dann nur wenige Millionen Euro, falls das Haus nicht vorher beim Unterhöhlungsprozess auseinanderfällt, würde seinen Zweck aber erfüllen – das Gerüst müsste dann nicht mehr auf dem Deichland stehen. Ich überlege kurz, ob ich den Ämtern eine E-Mail mit diesem Vorschlag schicke. Doch Tati kann mich abhalten. Nützt alles nichts. Das Geld ist weg.
Wie soll man das jetzt sagen im Nachhinein? Vor Corona, dem Zeitalter, als wir noch machen konnten, was wir wollten, war eine andere Zeitrechnung. Ohne Abstand und ohne Masken. Also war mir dieses Bild recht fremd: Auf dem Dach und im Dach stehen überall lauter Menschen mit merkwürdigen Werkzeugen und Masken. Das ganze könnte ein Ritual einer merkwürdigen Sekte sein, es sind aber die Reetdecker, die im Begriff sind, das alte Reet vom Dach zu bekommen. Altes Reet staubt – deswegen die Masken.
Lasst die Dacharbeiten beginnen!
Wie ich da so sitze, in einem Café und dieses Buch schreibe, da kommen zwei junge Frauen mit ihren Kindern und Babys rein. Die sitzen da so und sehen einfach glücklich aus, und ich frage mich, ob wir das wirklich alles verpasst haben, dieses einfach da sein mit unseren Kindern, Latte-Macchiato-Mama, und ich eine lange Elternzeit, das Leben mal Leben sein lassen, nur im Hier und Jetzt sein für unsere Kinder, ohne Ziel, ohne Plan, einfach so. Hatten wir das jemals? Ich glaube, ja. Da sind Erinnerungen. Aber sie sind durchzogen, wie Pilzfäden, von immer irgendwas, das unsere Welt bedroht. Da war immer irgendwas, die ewige Suche nach einem Haus, die vielen sinnlosen Banktermine, Angst vor dem Jobverlust, Frust, weil wieder ein Haus nicht geklappt hat, wieder und wieder und wieder, und jetzt sitze ich da, und so ist es jetzt aber nun mal, ich kann nichts daran ändern. Aber ich liebe es auch. Aber ich vermisse es auch. Der Mensch ist nie nur ein Mensch. Er ist immer ganz viele Menschen, die er ist oder sein möchte. Sie existieren parallel. Parallelwelten.

Die Männer in Masken lösen Reetbündel für Reetbündel vom Dach, schmeißen es zum nächsten Maskenmann, der es zum nächsten Maskenmann schmeißt, der es dann in einen LKW schmeißt. Vieles zerfällt schon vorher, und so bildet sich rund ums Haus eine Art Wall aus Reet. Das dauert ein paar Tage bis schließlich das Haus recht nackt dasteht. Nackt im wahrsten Sinne des Wortes. Erst jetzt fällt uns auf, wie gigantisch die Dachfläche ist, wie viel von dem Haus an sich einfach nur Dach ist. Vor einigen Jahren ist eins der ältesten Hufnerhäuser der Vier- und Marschlande in Neuengamme abgebrannt. Am Ende standen nur noch ein paar kleine Seitenwände, keine zwei Meter hoch, und der Ziergiebel, der ohne den Dachwalm nicht mehr viel von der ursprünglichen Pracht zum Ausdruck bringt (Menschen sind Gott sei Dank nicht zu schaden gekommen). Es war quasi nichts mehr übrig. Auch unser Haus wirkt befremdlich. Die Sparren und Querlatten, die das Reet getragen haben, sind derart dünn, dass ich nicht glauben kann, dass dieses Haus in diesem Bauzustand seit über 300 Jahren hier am Deich steht und Wind, Regen, Sturm, Sonne, Hitze, Schnee und alles Wetter, das es gibt, überstanden hat. Am Ende kommt eine Plane auf das Dach.
Dann wird es brutal. Unser Architekt hat uns schon vorgewarnt, aber jetzt, wo es passiert, ist es viel heftiger. Der Dachstuhl, wie er war, kann so nicht bleiben. Er muss für die gewerblich Nutzung als Ferienwohnung verstärkt werden. Es wird also ein neuer Dachstuhl über den alten gebaut. Das Haus wächst somit um ungefähr eineinhalb Meter. Des Weiteren wird die Neigung ausgeglichen. Das Haus ist im Laufe der Jahrhunderte an der westlichen Seite um 60 Zentimeter abgesackt. Eigentlich kein Wunder. Denn so ein Haus ist früher nicht auf einem festen Betonfundament gebaut wurden. Es gab lediglich ein partielles Feldsteinfundament. Das heißt, dass die Höftständer, die Hauptständer des Bauernhauses, die das gesamte Gewicht des Hauses tragen, auf Feldsteine gesetzt wurden. So entsteht eine gewisse Festigkeit. Das Haus ist zwar abgesackt, aber es hat nichts seiner Stabilität an sich eingebüßt. Es würde ewig so dastehen. Die ältesten Häuser, die baugleich zu unserem sind, stehen seit fast 500 Jahren in der Region. Holz arbeitet. Richtig verbaut und richtig gepflegt (heißt eigentlich nur, dass es trocken bleibt), hält Holz im wahrsten Sinne des Wortes ewig. Häuser in der heutigen Zeit können davon nur träumen.
Bevor der neue Dachstuhl auf das Haus gebaut werden kann, wird die Lattung abgenommen, sodass am Ende nur noch die Sparren erhalten bleiben. Außerdem werden alle alten und morschen Bohlen vom Dachboden herausgenommen und im Garten gesammelt. Der Berg, der sich über die Tage anhäuft und fast die gesamte Wiese neben dem Haus bedeckt, sollte viele Monate dort liegen bleiben. Kann sich kein Mensch vorstellen.
Anschließend werden mit einem Kran durch die Sparren hindurch Stahlträger an den Hauptträgerbalken des Dachbodens befestigt. Sie haben den Zweck, dem Haus eine neue Steifigkeit zu geben und die Neigung durch das Absacken auszugleichen. Auf diese neu entstandene Balkenlage werden gigantische Leimbinder-Holzbalken eingezogen. Sie bilden jetzt den neuen Boden vom Dachboden, auf dem der Dachstuhl aufgebaut werden kann.
Die Außenwände
Der haut den da rein!
Der Vorschlaghammer, ein Planet. Das Ding ist so riesig, dass ich den wahrscheinlich nicht mal einen Zentimeter vom Boden hochheben könnte, und der Zimmerer hebt den immer wieder hoch. Der hebt den nicht nur hoch, der schwingt den auch noch und schlägt damit. Der schlägt den Fachwerkbalken minutenlang – das waren bestimmt Stunden – da rein. Ein quer liegender Brüstungsriegel.
Der legt das schwere Vierkantholz aus massiver Eiche schräg zwischen zwei senkrecht stehende Pfosten. Auf der einen Seite steckt er den Zapfen in den Schlitz, auf der anderen Seite muss er mit dem Hammer so lange auf den Riegel schlagen, bis er waagerecht – also 90 Grad zum Pfosten – liegt.
Er schlägt und schlägt und schlägt. Doch der Riegel bewegt sich kein Stück. Ich guck da ganz genau hin. Da bewegt sich nichts. Minutenlang schlägt der da mit diesem gigantischen Hammer drauf. Dass der das Holz auch immer trifft. Profis, wahnsinn.
Dann erkenne ich ein leichtes Vorankommen. Ein halber Zentimeter in fünf Minuten bestimmt. Aber da fehlen noch mindestens zwanzig Zentimeter. Das heißt, der bräuchte, rein theoretisch, noch über drei Stunden.
Am Ende geht es doch schneller und der Balken ist schließlich an seiner Position. Ein Meisterstück. Kunst. Eine quasi archaische Erfahrung, ein Bild, das ich nie vergessen haben. Auch nach Jahren nicht. Denn Häuser werden schon seit Jahrhunderten, vielleicht sogar noch länger, genau so gebaut. Man vereint sich mit der Geschichte, man ist ein Teil des Ganzen, einfach nur, weil ein Mann mit reiner Muskelkraft einen Balken in einen anderen Geschlagen hat. So einfach ist das. Er erschafft damit so viel mehr als tausende Menschen an ihren tausenden Computern und Handys und sonstwas zusammen.
Es geht jetzt also an die Außenwände. Diese bedürfen auch einer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Denn dort, wo die Fachwerkbalken nicht mehr zu retten sind – also zu morsch, weil sie Jahre in der Nässe waren und nicht gleich Ausbesserung geschaffen wurde – müssen die Gefache, das Mauerwerk zwischen den Holzbalken, herausgebrochen werden. Anschließend werden mit speziellen Holzkonstruktionen die freien noch gut erhaltenen Balken abgestützt. Wir haben also permanent Tag der offenen Tür.
Und Tag des offenen Denkmals. Dieser Tag, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert wird, ist für alle enthusiastischen Denkmalbesitzer ein Muss. An diesem Tag kommen Interessenten und können sich das Denkmal anschauen. Auch wir nehmen Teil und sind begeistert, wie viele Menschen sich für unser Haus interessieren.
Freunde kommen vorbei, Bekannte und Unbekannte, Nachbarn und Nachbarn, die sogar in dem Haus geboren wurden. Sie erzählen uns viele schöne Geschichten. Sie erzählen von Lisa Voss, der letzten Verkäuferin in dem kleinen Krämerladen im Haus, und dass es da die besten Lakritzschnecken gab. Sie erzählen uns von unseren Mühlsteinen im Boden vor den Eingangstüren, dass auf dem Hof immer gebacken wurde und eine enge Zusammenarbeit mit der Altengammer Mühle ein paar hundert Meter weiter am Deich bestand. Ein normaler Bauer hätte sonst keine Mühlsteine am Haus. Und sie erzählten von Schlauchbootwettkämpfen im Elbarm vor unserem Haus der Freiwilligen Feuerwehren, von “Franz sin Franz sin Franz” – über Generationen hinweg hießen die ältesten Söhne der Familie Franz, und man sprach natürlich Platt –, und von der Geschichte mit dem Pferd in unserem Wohnzimmer. Zur Erntezeit, wenn die Heuwagen in die alte Diele fuhren und entladen wurden, musste das Pferd durch das Wohnzimmer nach draußen laufen, weil zum Wenden der Platz in der Diele nicht ganz reichte.
Als nach Wochenlanger Arbeit die fehlenden Holzbalken gegen neue ausgetauscht sind – alles massive Eiche – werden anschließend die alten Steine wieder eingesetzt. Diese wurden in wochenlanger Kleinstarbeit händisch von altem Mörtel oder Schmutz befreit. Mein Vater musste sehr an die Kriegsarbeiter denken, die gleiches taten. Nur unter anderen Umständen. Was können wir dankbar sein.
Steine, die fehlten, wurden in einer Spezialmanufaktur für uns gebrannt. Leider konnten wir keine original Steine aus den Vierlanden ergattern, obwohl es diese reichlich gegeben hätte:
Da brennt ein kleines altes Stallgebäude nieder. Alles weg, nur die Steine nicht. Also gehen der kleine Stefan und die kleine Tatiana doch einfach mal beim Besitzer fragen, ob wir nicht ein paar Steine abkaufen könnten.
“Wie viele braucht ihr denn?”, fragt der kleine dickliche Mann an der Tür seines Wohnhauses ein paar Meter weiter.
“Einige tausend.”, sage ich.
“Einige tausend?”
“Ja.”
“Jo.”
“Ginge das denn vielleicht?”
“Jo, warum nicht.”
“Oh, das ist ja schön. Und was würden die Steine so circa kosten?”
“Für was braucht ihr die denn?”
“Wir sanieren ein Haus in Altengamme. Am Altengammer Hauptdeich.”
“So. Soso.”
“Ja.”
“Na denn.”
“…”, wir schweigen.
“Einen Euro pro Stein.”
– “…”, wir einigen uns auf ein Nein.
Die Steine liegen noch heute da, über fünf Jahre später.
Ein anderes altes Haus, zum Abriss freigegeben. Wir hatten zufällig wegen einer anderen Sache Kontakt mit dem Besitzer. Den könnten wir auch noch fragen.
Beim Haus angekommen, stellen wir fest, dass alles eingezäunt ist. Wir klingeln an der Haustür seines Wohnhauses ein paar Häuser weiter. Dort erklärt er uns, dass er das Haus an eine Immobilien-Investitions-Bla-Firma verkauft hat und gibt uns die Nummer. Wir rufen an. Geht keiner ran. Wir probieren das tagelang. Irgendwann geht einer ran, der uns sagt, dass das mit den Steinen kein Problem sei. Das Haus wird ja schließlich abgerissen.
Wochen vergehen. Nichts passiert. Wir haben keine Zeit mehr zu warten, und nehmen die neuen Steine aus der Manufaktur.
Monate später bekommen wir einen mehrseitigen Vertrag der Firma zugeschickt, in der wir sonstwas alles ausfüllen, bestätigen und versichern müssen. Bla.
Das Haus steht noch heute da. Der alte Besitzer sagt uns, die Firma kauft alle Häuser weg, die man zu irgendwas machen oder abreißen und neu machen kann, bevor eine Genehmigung für irgendwas daliegt. Erstmal haben. Haben ist besser als brauchen. Wenn die Ziele umgesetzt werden dürfen, werden sie umgesetzt. Wenn nicht, wird wieder verkauft. Toll, was man alles machen kann, wenn man Geld hat.
Das gibt noch Bilder, auf denen Tati durch die offenen Hauswände schaut. Ein Bild ist mir auch besonders in Erinnerung: Da steht ein Maurer in der Diele auf dem offenen Sandboden und hält die Schaufel in der Hand, wie so eine Siegerpose, nachdem der Drache erlegt wurde. Hinter ihm ist von der Mauer nur noch das Fachwerk übrig. Die restlichen Steine waren herausgebrochen. Das Bild in der hohen Diele wirkte dadurch ein bisschen wie in einer alten Kathedrale.
Draußen im Garten auf der Wiese ist der Berg an altem Holz noch größer geworden. Ein Gebirge. Es ist unvorstellbar. Was soll damit passieren, wie soll ich in einem Menschenleben das alles jemals wegbekommen? Selbst wenn ich es wegschmeißen würde. Da müsste ich einen LKW ausleihen. Geht doch gar nicht. Aber wegschmeißen kommt irgendwie auch nicht in Frage. Das ist Holz. Auch wenn man es nicht mehr konstruktiv verbauen kann, weil es morsch oder wurmstichig ist, ist es doch bestimmt noch zu etwas gut. Doch wohin damit?
Noch Monate später beschäftigt mich das Thema. Ein Freund von uns holt über Wochen vieles ab, das er bei sich zum Heizen noch gebrauchen kann. Und ich sortiere eins nach dem anderen. Wochen lang. Aus stabilen Balken kann man vielleicht doch noch mal etwas machen. Aus vernünftigen Brettern kann man vielleicht Regalböden machen oder Verschalungen. Aus besonders verformten oder verrotteten kann man Deko machen. Den Rest zersäge ich in handlich Stücke. Vielleicht hab ich mal eine Feuerschale.
Weitere Monate werde ich mit Räumen des Holzes verbringen. Erst von da nach da, weil da wieder was anderes hinkommt, dann von hier nach dort, weil auch hier wieder was geplant ist. Das hört nie auf.
Innere Werte
In der Diele geht es weiter. Die später eingezogenen Bürowände werden als erstes entfernt, um die ursprüngliche Halle des Fachhallenhauses wieder freizulegen. Hier habe ich dann auch erkannt, dass die erste Arbeit im Haus, die ich überhaupt geleistet habe – nämlich das Entfernen der nassen Deckenbalken in dem einen Büroraum – völliger Schwachsinn war. Es wird einfach alles abgerissen.
Danach müssen an der westlichen Seite neue Höftständer eingebracht werden. Die alten wurden im Zuge der Büroräumlichkeiten nämlich einfach abgesägt und an anderer und statisch fraglicher Stelle mit Eisenträgern ersetzt.
Für die neuen Höftständer, die ja das gesamte Gewicht des Hauses tragen, werden neue Fundamente gegossen. Später werden die mächtigen und mehrere Hundert Kilo schweren Eichenbalken dann eingefügt. Ein kniffliges, im wahrsten Sinne des Wortes, Unterfangen.
Danach wird der gesamte Boden des Hauses einen Meter tief ausgehoben, heißt, dass ein Dutzend Männer mit Schaufeln und Schubkarren händisch viele viele Tonnen Sand nach draußen befördern. Auch dieser Haufen ist unfassbar. Hoch, breit, Dünen. Wochen dauert das. Schubkarre für Schubkarre. Ein Aufwand sondergleichen. Erst danach kann der Beton für das neue Fundament gegossen werden. Im Laufe der mittlerweile fast ein Jahr andauernden Arbeiten am Haus beschleicht mich die leise Angst, ob wir das alles jemals refinanzieren können.
Man könnte, was kommen sollte, folgendermaßen zusammenfassen:
“Wo sollen denn jetzt die ganzen Steckdosen in der Diele hin?”, fragt mich Tati am Telefon, während ich auf der Arbeit gerade ernste Probleme mit der Website eines Kunden habe.
“Ähm, ja, warte, kann ich dich zurückrufen?”
Cut.
“Der Architekt sagt, dass die Raumaufteilung in Wohnung drei so nicht funktioniert. Das passt mit der Sauna so nicht.”
“Okay … was ist denn das Problem?”, ich wieder so am Handy auf der Arbeit.
“Der Platz reicht einfach nicht.”
“…”
“Schatz, bist du noch da?”
“Ja. Jaja.”
“Und?”
“Ja – keine Ahnung!”
Cut.
“Schatz, der Bauleiter, er will wissen, wann wir jetzt endlich die Baubesprechung machen können.”
“Warte”, ich so beim Essen in der Pause auf der Arbeit. “Ich frage nachher mal nach beim Chef.”
“Nein, der will das jetzt wissen!”
“Äh, okay? Was soll ich machen? Ich meine, ich bin in der Pause. Ich kann jetzt auch nur raten!”
Cut.
“Da passen keine zwei Waschbecken hin! In den Damen-WCs in der Diele! Unmöglich!”
“Was?”, wieder auf der Arbeit.
Cut.
“Die Hochebene, die Tischler sagen, dass da niemals eine platzsparende Treppe machbar ist. Da geht nur eine Leiter!”
“Nein! Das hab ich schon mal gesagt. Mit einer Leiter wird das niemals richtig genutzt. Dafür ist der Platz zu kostbar bei uns!”, wieder auf der Arbeit.
“Das geht aber nicht. Was soll ich machen?”
“Keine Ahnung! Was soll ich von hier machen? Ich gucke mir das heute Abend mal an.”
“Die wollen das aber wissen!”
“Ja, Scheiße!”
Cut.
“Die Bar, hatten wir da nicht schon einen Plan gezeichnet?”
“Nein.”, Arbeit.
“Aber die Elektriker müssen jetzt wissen, wo überall Starkstrom hin soll. Wollten wir bei uns nicht auch im Bad was haben, wegen Industriewaschmaschine?”
“Äh…”
Und so weiter und sofort.
Einmal fahren wir in den Harz. Die ganze Fahrt haben wir über nicht anderes als über die paar Lichter in der Diele, wo einmal das Café sein und die Feiern stattfinden sollen, gesprochen. Stundenlang. Stunden, nur für ein paar Lichter.
Das andere Mal haben wir uns über Wochen den Kopf zerbrochen, ob wir in der Diele eine kleine Galerie einbauen lassen sollen oder nicht. Das Problem ist immer das Gleiche – man kann es sich noch so gut vorstellen oder aufzeichnen, oder auch in 3D bauen lassen – wenn es in der Realität erstmal da ist, ist es doch ganz anders. Oder auch nicht, wenn man Glück hat. Aber dieses Risiko wird man nicht ausmerzen können. Am Ende haben wir uns für die Galerie entschieden. Und hatten Glück.
To Dos schaffen To Dos schaffen To Dos
Jetzt schreibt Tati:
Drei Seiten in kleinster Schrift. So lang war mittlerweile meine “To Do” Liste. Immer, wenn ich einen weiteren Punkt auf der Liste abhaken konnte, überkam mich ein tiefes Gefühl von Befriedigung – einfach geil! Leider war genau das nicht so häufig der Fall. Zwischenzeitlich habe ich überlegt, ob ich “Kaffee trinken” mit auf die Liste schreiben sollte, damit ich wenigstens einen Punkt täglich durchstreichen kann.
Zeitdruck, mein täglicher Begleiter. Um elf Uhr war die nächste Baubesprechung angesetzt, Mathilda müsste also sofort gestillt werden, damit ich nicht barbusig bei der Besprechung auf der Baustelle erscheinen würde.
Mein Körper: eine einzige müde Masse. Die Nacht war kurz (wahrscheinlich Bauchschmerzen oder ein Zahn oder oder oder, reden kann sie noch nicht…). Mein Kind: Schläft seelig und erholt sich von der stressigen Nacht.
Ich versuche sie aufzuwecken. Keine Chance. Also nehme ich das schlafende Bündel, lege es auf die Wickelkommode und ziehe es warm an, damit ich es in die Babyschale legen kann. Ihre Lider flattern, sie schläft immer noch – ich bin neidisch. Jede junge Mutter kennt das: Der Schlafentzug raubt einem jegliche Energie. Alle zwei Stunden stillen, 24/7h Milchbar Bereitschaft, das Gehirn fängt langsam mit Wortfindungsstörungen an. Kein Wunder, dass Schlafentzug im Mittelalter eine Foltermethode war.
Jetzt aber schnell: Mit der Babyschale im Auto geht es zur Baubesprechung von Kirchwerder nach Altengamme. Kurz bevor wir ankommen wacht Mathilda auf und hat von jetzt auf gleich: Hunger. Kein Witz, die Comics übertreiben nicht: Das Baby schlägt die Augen auf und schreit, als ob es den Hungertod stirbt. Zum Glück ist das Auto von der 20-minütigen Fahrt aufgeheizt – sonst würde ich mir die Brust abfrieren im Winter. Ich halte ein paar Meter vom Haus entfernt und stille Mathilda im Auto. Ich habe noch fünf Minuten. Wird knapp. Und so komme ich mit zehn Minuten Verspätung zur Baubesprechung.
Das Kind vor meiner Brust ist im Tuch eingepackt. Mit Kinderwagen oder zappelndem Baby auf dem Arm in einer Bauruine herumzukrabbeln ist keine so gute Idee. Im Tuch ist sie geschützt vor dem kalten Wind und warm verpackt.
“Ach Frau Timmann, da sind Sie ja”, unser Architekt streckt mir die Hand entgegen.
Zusammen mit einigen Handwerkern stehen sie vor riesigen ausgedruckten Architekturplänen von unserem Haus.
“Wir haben da leider ein kleines Problem, das sich beim Ausbau ergeben hat”, führt der Architekt fort.
Ich kenne das schon: Diese Höhe passt nicht, das Material ist doch nicht geeignet, oder hier muss noch bei den gesetzlichen Vorgaben etwas angepasst werden, weil der Raum einen Quadratmeter mehr hat und damit andere Bestimmungen laut Vorschrift XY gelten. Überhaupt – diese ganzen Vorschriften und Auflagen: Brandschutz, DIN-Normen, Lizenz für die Schankwirtschaft. Gesetze über Gesetze. Und alle unterschiedlich. Mein Kopf raucht.
Wir gehen durch das ganze Haus. Mathilda gluckst glücklich vor sich hin und bekommt von dem ganzen Rauch im Kopf nichts mit.
“Wir nehmen die alte Querlattung raus und machen dann eine Gipskartonverschalung hier ans Dach”, zeigt mir der Architekt gerade.
Meine Alarmglocken klingeln: “Wieso das denn? Die alten Dachsparren mit Weidenverbund sollten doch eigentlich von innen sichtbar sein. Das ist ja schon etwas Besonderes.” Jetzt klingelt auch irgendwo mein Telefon in den Tiefen meiner Tasche.
“Das geht leider nicht”, wieder der Architekt.
“Wieso?”
“Laut einer Brandschutzauflage, die das Bauamt wollte, muss nach dem Reetdach die Dachunterspannbahn, die Dampfsperre, eine Dämmschicht und danach die Rigipsplatten kommen. Das sind…”, er zieht seinen Zollstock aus der Jacke: “…so ca. 30cm Dachaufbau. Das muss alles hinter die alte Querlattung gebaut werden. Die sind aber nicht mal 20cm vom Reet entfernt.”
Er fuchtelt weiter mit dem Zollstock herum und zeigt mir mit dem Finger die 20cm, die die alten Sparren entfernt sind: “Heißt im Klartext, wir müssen leider die alte Querlattung entfernen. Und den ganzen Dachaufbau machen und sie dann eventuell partiell wieder ansetzen? Das ist alles nicht so einfach. Das eine möchte man, das andere muss man. Verstehen Sie, was ich meine?”
Ich bin ein bisschen ernüchtert, aber was sollen wir machen.
Mein Telefon klingelt. Schon wieder. Ich krame es aus den Tiefen meiner Tasche, Mathilda gluckst auf meinem Arm. Das Display zeigt die Nummer von Ann-Berit, unserer ersten Braut, die bei uns ihre Hochzeit feiern möchte, an (hat von Bekannten von Bekannt von uns gehört). Ich habe ihre Nummer schon eingespeichert. Unser Haus ist noch ein Rohbau, sie hat es noch nicht einmal gesehen, es ist unglaublich. Ich stehe hier in einem Rohbau und sie hat diesen Rohbau für eine der wichtigsten Feiern im Leben gebucht in der Hoffnung, dass es dann nicht nur fertig ist, sondern auch schön, geschmackvoll, stilecht, passend.
“Ich bespreche das mal mit meinem Mann”, sage ich noch kurz zu unserem Architekten, wende mich dann mit meinem Telefon ab und spreche kurz mit Ann-Berit. Danach rufe ich Stefan auf der Arbeit an, doch er geht nicht ran. Ist wohl in einem Meeting.
Ich wende mich wieder dem Architekten zu: “Okay, ich verstehe das Problem. Aber gibt es keine andere Lösung?”
“Leider nein. Wir müssen uns an das Brandschutzkonzept halten. Wir könnten die alten Sparren wieder an dem Rigips anbringen. Aber das sieht nicht gut aus und wird sehr teuer”, stellt der Architekt klar.
Ich bleibe ernüchtert. Zwischen der Realität und Pinterest gibt es eben doch eine gewisse Kluft: “Okay, aber können wir dann wenigstens die Hauptständer vom Dachstuhl stehen lassen und den Rigips drumrum schneiden?”
“Das sollte zu machen sein”, sagte er.
Permanente Panik
Jetzt schreibt wieder Stefan
So und so weiter. So geht das immer. Das hört nicht auf. Das geht über Wochen, Monate, Jahre so. Am Anfang ist die Anspannung, dass wir etwas falsch machen oder planen oder umsetzen lassen so hoch, dass wir permanent in einer Art Panikzustand leben. Ich, die ganze Zeit auf der Arbeit, Tati, wenn überhaupt, mit Mathilda ab und zu auf der Baustelle und auch nur mehr schlecht als recht in der Lage, derartige Entscheidungen zu treffen. Quasi zwischen Tür und Angel müssen Entscheidungen getroffen werden, die unser ganzes Leben bestimmen. Und unser Leben in dem Fall heißt ja nicht nur, wie wir wohnen werden – was ja mit drei Kindern auch nicht zu unterschätzen ist – sondern auch, wie wir arbeiten können oder eben nicht. Diese Entscheidungen bestimmen zum großen Teil über das, was wir verdienen können. Denken wir nicht genug nach, hat das gravierende Auswirkungen, die unser ganzes Geschäft gefährden könnten. Das Hauptproblem – kennt jeder, der mal was mit Häusern zu tun hatte –, wenn etwas erstmal falsch eingebaut, gemauert, gezimmert oder sonstwas wurde, geht es danach nicht mehr zu ändern. Also, geht schon, aber eben nur mit einem nicht mehr wieder gutzumachendem Verlust – Stichwort Monetarisierung und so weiter.
Was wir im Laufe der Zeit aber auch verstehen, und das steht eigentlich im Kontrast zu den vorherigen Erfahrungen: Geht nicht, gibt’s nicht. Wie oft haben wir gehört, dass Dinge nicht umzusetzen sind. Dann denkst du selber mal ein, zwei Nächte drüber nach, und auf einmal findet sich doch eine Lösung.
Ein Bild für die Ewigkeit: Mathilda steht mit weit geöffnetem Mund in der Duschkabine und presst ihre Zunge gegen die Glasscheibe.
“Schatz, das sind fünf Geschosse!”, rufe ich.
“…”, Tati ist nicht weiter beeindruckt.
“Alter, das sind zehn Fußballfelder, diese Halle!”, rufe ich weiter.
“Was sollen wir denn machen?”
“Ja, ist ja gut!”
“Papapapap, gibt es da einen Fahrstuhl?”, möchte Johanna wissen.
“Bestimmt.”, antwortet Mama.
Wir sind im Fliesenzentrum irgendwo in der Pampa in irgendeinem riesigen Gewerbegebiet in Hamburg. Wir müssen und wollen natürlich auch Wandfliesen für acht Bäder und Bodenfliesen für 14 Räume aussuchen. Wir haben Angst. Und wir haben Hunger. Zumindest drei von uns – David, Johanna, Mathilda.
“Wir sind doch gerade erst angekommen!”, fauche ich.
“Aber ich habe Hunger.”, wiederholt David.
“Das wird niemal was.”, Tati.
“Können wir zu McDonalds?”, will David wissen.
“Willi wills wissen!”, rufe ich und laufe weg.
“Toll.”, Tati schließt die Augen. “Mäuse, wir beeilen uns, okay. Wir haben ein bisschen Naschis mit, okay?”
“Jaaaaaa!”, alle sind glücklich.
Nach ein paar Minuten hat Tati mich eingeholt. Die Auswahl erschlägt uns, das ist nicht zu fassen, Millionen Fliesen so weit das Auge reicht. Stunden verbringen wir in dieser Fliesenwelt und gehen immer wieder von oben nach unten und zurück. Zwischendurch bleiben wir immer wieder an manchen von ihnen kleben. Wir betrachten sie, wir spüren etwas, etwas Magisches, das könnte passen, und dann passiert etwas Besonderes. Bei allen Fliesen, für die wir uns entscheiden, sind wir uns sofort einig. Es soll so sein.
Fußnote: Danke an der Stelle an die vielen Handwerker für die geile Arbeit und Klaus und Martin, die es erduldet hatten, dass ich ganz ab und zu auf zwei Hochzeiten getanzt habe.
Ein Wald, eine Idee und vier Hütten
Das hat ja schon lange in uns geblubbert, dieser kleine Wald bei uns am Haus. Zuerst wollten wir da Baumhäuser für Gäste bauen. Aber dann war schnell klar: viel zu hohe Auflagen. Sobald es Gewerbe wird, nein, nein, nein. Das wäre auch viel zu teuer. Um mit dem Baumhaus hoch genug zu kommen, um über den Deich schauen zu können, müsste man schon 15 Meter hoch bauen. Nein.
Irgendwann hat uns Andreas, unser guter Freund, Koch, Gewürzemacher und Lebenskünstler mal aus seiner Kindheit erzählt, von drüben, also der ehemaligen DDR, Rügen, wo wir auch immer hinfahren, und von irgendwelche Finnhütten. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Aber dann ist es uns gekommen: Diese sogenannten dreieckigen Nurdachhäuser wären doch perfekt für unseren Wald. Kleine Waldhäuser. Und so fangen wir an zu recherchieren.
Ein paar Wochen später. Erst Rügen, dann ein Tagesausflug nach Greifswald und danach Wolgast.
“Die sind perfekt!”, ruft Tati als wir beim Zimmerer angekommen sind.
Überall stehen da diese irgendwie verzauberten Finnhäuschen rum. Manche ganz klein, andere mittel, und, ich glaube, andere könnten auch als normales Haus durchgehen.
“Die Kleine, lass uns die Kleine mal genauer anschauen”, ruft Tati weiter.
Wir öffnen die Tür, verlieben uns schlagartig und sehen die Hütte schon in unserem Wald stehen. Alles Holz, schräge Wände, es duftet nach Fichte, eine Tür, zwei Fenster, was braucht es mehr. Drei, vier Stück müssten wir in den Wald bekommen, das könnte unserem Haus, dass an sich doch schon sehr teuer ist, vielleicht geschäftsmäßig ganz gut tun.
Wir einigen uns preislich recht schnell mit dem Zimmermeister und setzen wie gewohnt unseren Urlaub fort.
Wieder in Hamburg befassen wir uns mit dem Baurecht. Diese Hütten sind keine vier mal vier Meter, sie könnten rein theoretisch auf Rädern stehen, und wir schlussfolgern nach einigen Tagen Recherche, dass wir dafür keinen Bauantrag bräuchten.
“Was? Das kannst du vergessen!”, ermahnt uns Björn, den wir über unsere Bauphasen und Vierlanden-Vereine kennengelernt hatten, in seiner rustikal norddeutschen Art als wir ihm eines Abends bei einem Bier im Gasthof von unserem Plan erzählen. “Das kannst du vielleicht privat machen. Aber sobald da jemand übernachten soll, funktioniert das nicht mehr als fliegende Bauten oder so etwas.”
“Öh.”, ich bin verwirrt.
“Das ist ja ein riesiger Unterschied. Privat oder geschäftlich.”
“Ja.”
“Stimmt.”, Tati steigt jetzt auch mit ein.
“Und nun?”, frage ich.
“Ja, also, ich glaube, dann müssen wir wohl ganz normal einen Bauantrag stellen.”, schlussfolgert Tati.
“Ja.”, meint auch Björn.
Verdammt, wäre zu schön gewesen. Ist ja nicht so, dass wir nichts anderes noch zu tun hätten. Aber vielleicht kann das unser Architekt übernehmen.
“Das soll ich wohl hinkriegen.”, kommt prompt seine Antwort und wir freuen uns, dass der Baunantrag nach einigen Überlegungen und hin und her schließlich zum Bauamt geschickt werden kann.
Die Wochen vergehen, doch wir hören nichts vom Bauamt. Zaghaft formulieren wir eine E-Mail und schicken sie ab. Keine Antwort. Dann rufen wir an. Kann keiner was zu sagen. Wir sind ein bisschen ratlos.
Dann: Abgelehnt!
“Abgelehnt?”, kreischt Tati und kann es nicht glauben, als sie den Briefumschlag öffnet. “Das soll ja wohl ein Witz sein!”
“Abgelehnt?”, rufe ich, mein Puls auf 180.
“Ja, abgelehnt! Das glaub ich jetzt nicht!”
“Das kann doch nicht wahr sein! Wieso dass denn? Steht da was?”
“Bla!”
“Was?”
“Keine Ahnung, irgendwas mit Außenbereich, bla!”
“Was?”
“Hätten wir den Antrag bloß nie eingereicht!”
“…”, ich setze mich.
“Was machen wir denn jetzt?”
“Mann, keine Ahnung, aber das kann doch nicht wahr sein! Wir haben die ganzen Hütten doch schon bestellt. Die sind bezahlt! Wenn wir die jetzt nicht bauen dürfen, was sollen wir denn dann machen? Das ganze Geld ist für den Arsch?”
“Keine Ahnung!”
“Vielleicht können wir die noch verkaufen.”
“Verkaufen? Ich will die nicht verkaufen, ich will die hier bauen!”
“Ja, aber was weiß ich denn?”
“Neinneinnein! Das kann nicht sein!”
“Nein!”
Ich rufe da an: “Timmann, hallo…”, das kann nicht sein, ich will da jetzt direkt beim Bauamt nachfragen. Geht keiner ran. Anrufbeantworter, bla. Ich probiere es wieder. Keiner da. AB, bla. AB, bla. AB, bla!
Irgendwann dann doch: “Krüger, Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt Bergedorf.”
“Ja, Timmann, hallo, es geht um den Bauantrag mit dem Aktenzeichen …”, so und so und so und so. Ich spreche und frage und diskutiere und frage wieder und spreche ziemlich lange mit der Dame bis mir nichts mehr einfällt. Nur eins noch: “Dann schauen sie doch mal drum rum. Da ist doch überall was. Da sind irgendwelche Ställe, Lagerhallen, irgendwelche Butzen, was ist denn da jetzt der Unterschied, wenn wir bei uns ein paar kleine Hütten hinstellen?”
“Außenbereich.”
“Ja, ich weiß, aber bitte, gucken sie doch noch mal, ich meine, jetzt mal ehrlich, die Hütten könnten auch auf Rädern stehen. Bitte schauen sie doch mal, dass bei mir in der Umgebung überall hier und da was ist. Unsere klitzekleinen Hütte fallen da doch nicht auf.”
“In meinen Akten kann ich da aber gar nichts sehen.”
Ich überlege kurz, dann: “Ja, gut, dann ist das so. Aber gehen sie doch bitte einmal zu google-Maps, nur so, und schauen sie mal, was da alles ist.”
Schweigen.
“Hallo?”, frage ich verzweifelt.
“Ja.”
“Können sie einmal schauen?”
“Nein.”
“Was, bitte?”
“Das kann ich hier nicht machen.”
“Wie meinen sie das?”
“Ich kann hier nicht zu google-Maps gehen.”
“Was, wie meinen sie das? Dürfen sie das nicht?”, ich werde etwas lauter.
“Nein, nein, ich kann das nicht. Ich habe hier kein Internet. Nur Intranet.”
Ich schmeiße das Telefon auf das Sofa und rufe: “Schatz, geh da ran, bitte geh da ran, ich raste aus!”
“Was ist denn?”, fragt sie verdutzt.
“Die hat da kein Internet!”, flüstere ich so laut, dass die Grenze zum Schreien recht fließend ist.
“Was?”
“Geh da jetzt ran!”
“Hallo?”
“Hallo?”, die Dame vom Amt. “Ich habe sie gerade nicht richtig verstanden.”
“Hallo, ja, mein Mann hat sich … äh, mein Mann ist gerad – einen Moment –, der ist gerade umgeknickt.”
“Ah ja.”
“Aber alles okay.”
“Ich sagt ja bereits, das ist Außenbereich bei ihnen.”
“Ja”, die reden noch gefühlte zwei weitere Stunden, doch ich bin weg, Deich, Elbe, Wasser, Kopf rein, Kopf platzt, Tod, wiedergeboren, von vorne. Was jetzt?
Über unser Engagement im Rieck Haus haben wir tatsächlich einige Lokal-Politiker kennenlernen dürfen und richten uns mit unserer Problematik an sie. Sie bringen das ganze in den Regionalausschuss und bewirken, dass wir einen leicht geänderten weiteren Bauantrag stellen können.
Das alles dauert viele weitere Monate – und wir bangen jeden Tag. Aber dann endlich kommt ein weiterer Brief vom Bauamt.
Wir dürfen die Hütten bauen, und unsere Erleichterung ist so groß, dass fliegen.
Endlich kann ich mich genauer mit der Anleitung der Hütten befassen. Die Zimmerer bauen die Häuser natürlich auf, aber die neun Punktfundamente, die die Hütten brauchen, müssen wir schon selber machen.
Mein Gott, das kann ja wohl nicht so schwer sein, ein paar Punkte zu verteilen. Neun Punkte für neun Punktfundamente, alle eine Höhe. Mein Vater ist da. Der Wald ist nass. Der Boden noch viel mehr.
Wir diskutieren rum, bis wir uns irgendwann eine Art Schablone aus langen Holzbrettern zusammenbauen. Darüber können wir die Fundamente gut verteilen und die Höhen auch gut anpassen.
“Stefan, warte, ich habe eine Idee”, mein Vater stoppt und nimmt die Wasserwage vom Brett.
“Was denn?”
“Stützflore. Wir besorgen uns Stützflore vom Baumarkt, dann müssen wir hier nicht so tief in den Boden buddeln und beschädigen die Wurzeln der Tannen nicht so doll.”
Ich verstehe nur Bahnhof: “Stütz… was?”
“Stützflor. Das sind so Art Betonringe, wo man Pflanzen reinsetzen kann.”
“Ich verstehe nur Bahnhof.”
“Da kannst du beim Baumarkt nachfragen. Das zeigen die dir dann. Das brauchen wir erstmal, dann machen wir erst weiter.”
“Okay.”
Ein paar Tage später, Baumarkt.
“Stützflor?”, frage ich einen Mitarbeiter.
“Stützflor. Auf der anderen Seite.”
“Ah.”, in Bergedorf gibt es eine Drive-Through-Arena. Da fährt man mit dem Auto durch. Ich weiß jetzt warum.
“Stützflor?” frage ich wieder.
“Stützflor. Ganz hinten draußen links bei den Pfosten.”
“Danke.”
Oh mein Gott, soll das ein Witz sein? Wie schwer kann ein Ring sein? Ich kann das nicht glauben, habe meine Handschuhe auch erstmal schön vergessen. Die Dinger sind scharf wie Rasierklingen. Was für einen Sinn ergibt das? Als ich den ersten vorsichtig hochhebe, fällt er mir auch direkt aus der Hand. Ich springe zur Seite, wie eine Explosion oder so, doch das Ding erwischt mein Schienbein. Durch die Hose, ich blute durch die Hose. Mein Gott, die Bauarbeiterwelt muss ich mir echt erst noch einverleiben.
Nach einiger Zeit ist der Anhänger und das Auto, Beifahrersitz, hinten, Kofferraum, alles voll. Ein tiefergelegter Porsche wäre neidisch, so tief kann gar kein Auto liegen. Ich fahre lieber nicht über die Autobahn zurück.
Ein paar Tage später ist mein Vater wieder da, im Gepäck ein paar Säcke Beton. Er ruft mich zu sich, Säcke schleppen. Bin ich ja schon gewöhnt.
“Komm, lass uns die den Deich runterrollen, dann müssen wir nicht so weit schleppen.”, sage ich noch.
“Stefan, nimm doch die Schubkarre, dann geht das doch auch.”
“Nein, wir probieren das jetzt.”
“Das funktioniert nicht.”
“Warum?”
“Stefan.”
Warum?, ich bin ja so dämlich. Direkt der erste Sack, den ich noch so vorsichtig den Deich hinunterkullern wollte, zerreißt und verteilt den ganzen Beton bei ordentlich Wind über den ganzen Deich.
“Stefan”, mein Vater wieder.
“Fuck!”, ich schreie.
“Hey, Stefan!”, er sagt es so, als ob ich etwas Schlimmes gesagt hätte.
Gut, der klassische Weg. Sack für Sack in die Karre und alles nach hinten in den Wald.
“Hol mal ein paar Gießkann Wasser!”, ruft er und sucht sich alles Werkzeug zusammen. “Wir müssen den jetzt vernünftig anmischen.”
Praktischerweise liegt gerade ein halbe Sandgrube Sand bei uns auf der Wiese vor dem Bauernhaus. Die Maurer müssen für das Fundament unser Haus erstmal einen Meter am Boden von Sand befreien. Und so hole ich die erste Karre Sand und schaufel so viel wie mein Vater sagt in die Bütt mit dem Beton. Er gießt etwas Wasser nach und fängt an zu rühren.
“Jetzt du!”, ruft er plötzlich.
Ich nehme die Schaufel und fange an zu rühren. Alter, wieder so schwer. Kann da nicht ein Mal was einfach sein, so als Bauarbeiter. Ungelenk wie ein Elefant im Porzellanladen schwurbel ich da rum und rutsche plötzlich weg. Der Beton spritzt durch die Gegend.
Mein Vater lacht sich schlapp: “Stefan, was machst du denn? Du gehst doch ins Fitnessstudio.”
“…”, ja, das frage ich mich auch.
Irgendwann ist der Beton doch gut durchmischt und wir kippen ihn zu zweit vorsichtig in den ersten Stützflor, den wir per Schablone auf dem Boden positioniert haben.
“Soll das ein Witz sein?”, frage ich kritisch.
“Was denn?”, mein Vater versteht nicht ganz.
“Da fehlen ja nochmal zehn Ladungen.”
“Stefan. Zehn nicht, aber zwei, drei vielleicht schon.”
Ich kann das gar nicht glauben. Der ganze Aufwand gerade und wir haben noch nicht mal einen einzigen Stützflor ausgefüllt.
“Das dauert ja zehn Jahre.” stelle ich verzweifelt fest.
“Ja, das dauert seine Zeit. Was denkst du denn?”, mein Vater weiß Bescheid.
Ich weiß nicht, wie lange wir insgesamt gebraucht haben, aber irgendwann hatten wir alle Stützflore fertig. Das Fitnessstudio konnte ich mir noch lange sparen.
Eines Tages kommen die Zimmerer und setzen die Hütten drauf. Nach ein paar Tagen war alles fertig. Das ging hundert mal schneller, als die paar Fundamente.
Eines Abends setze ich mich da rein in eine Hütte und werde ganz leise. Obwohl noch nichts in der Hütte steht, ist es sehr gemütlich. Die Sonne scheint durch unser Tannenwäldchen und das kleine Fenster der Hütte in vielen kleinen Lichtpunkten auf den Holzboden. Die Vögel zwitschern.
Tati kommt dazu und setzt sich neben mich auf den Boden: “Also ich würde hier gerne Urlaub machen.”
“Ich auch.”
Sechs und noch mal sechs Löcher für zwei Zelte
Ich krieche da richtig rein. Klatschnass geschwitzt, röchelnd, alles voll Erde, Matsch, Nadeln. Kann man alles nicht glauben, kann sich kein Mensch vorstellen. Ich grabe dieses Loch, nein ich grabe sechs Löcher, aber schon beim ersten möchte ich gerne wegrennen. Ein Meter muss das schon sein, hat mein Vater gesagt. Gut, denke ich, ein Meter ist ja nun auch wirklich nicht die Welt. Aber – falsch gedacht. Ein Meter, der die Welt bedeutet. Ich dämlicher schwächlicher Klick-Werber-Futzi, das kann doch nicht so schwer sein, ein ein Meter tiefes Loch zu graben.
Ich fange jetzt mit dem zweiten an. Spaten in die Hand und ein paar Hiebe in die Erde. Noch ein paar, noch ein paar, noch ein paar. Ich kann schon wieder nicht mehr. Jetzt muss ich mit der Hand weitermachen. Das Loch ist zu tief, um da noch Erde mit dem Spaten hochschaffen zu können. Immer tiefer lange ich in das Loch, da fällt mir der Wurzeltod von meinem Vater ein. Das ist eine mindestens 300 Kilo (15 Kilo für Handwerker) schwere Eisenstange mit einer scharfen axtartigen Klinge am Ende. Das haut man in den Boden und bei Belieben in größere Wurzeln eines Baumes, die einem im Weg liegen sollten. Damit kann man aber auch vorzüglich das Loch in der Tiefe auflockern und dann die Erde mit der Hand hochholen. Das erleichtert das Ganz doch erheblich.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden es gedauert hat – ich denke, ich habe 15 Kilo abgenommen – aber irgendwann waren sie alle geschafft: sechs ein Meter tiefe Löcher. Endlich kann ich die Pfosten, die ich vorher besort habe, für die zwei Baumzelte in die Löcher stecken und wieder zumachen, das heißt, die Erde wieder in die Löcher füllen und ordentlich verdichten.
Baumzelte. Dieser ganze Aufwand mit den Löchern und Pfosten ist für unsere Baumzelte, die wir extra aus Australien haben importieren lassen. Da fliegt man drin. Wie in einer Hängematte liegt man da im Zelt in den Bäumen und guckt, wenn man das Cape abmacht, durch die Baumkronen in den Sternenhimmel. Man schwebt über dem Boden.
Das Zelt wird eigentlich an drei Bäumen mit Spanngurten befestigt. Der sich ergebende dreieckige Boden des Zeltes steht allerdings so unter Spannung, dass wir gleich wussten, dass wir diese Spannung nicht ein ganzes halbes Jahr auf unsere paar Bäume im Wald ausüben lassen wollten. Daher die Löcher mit den Pfosten. Dort hängt das Zelt besser (dachte ich).
Am nächsten Tag habe ich die Baumzelte also dabei, lese mir die Anleitung in Ruhe durch und setze schließlich an. Ich nehme den ersten Spanngurt und befestige ihn mit einer Schlaufe am ersten Pfosten. Das wiederhole ich mit dem zweiten und dritten und fange an, vorsichtig die Gurte zu spannen. Erst ein bisschen beim ersten, dann beim zweiten, dann beim dritten. Das wiederhole ich so lange, bis sich eine gewisse Spannung aufbaut.
“Die biegen sich ja ganz schön, Stefan”, mein Vater kommt um die Ecke.
“…”, ich schweige.
“Guck mal hier, das sieht aber nicht gut aus.”
“Was?”, ungläubig gehe ich ein paar Schritte zurück.
“Komm, hier, komm mal hierher.”
“Hm”, ich gucke da ganz genau hin. Zwei Möglichkeiten gehen mir durch den Kopf. A: Ich schließe ein Auge und drücke so fest mit dem Finger in das noch offene andere Auge bis sich die Biegung des Pfostens ausgeglichen hat und ich einen geraden Pfosten sehe. Das könnte allerdings unangenehm werden. Sowohl für mein Auge, als auch – und ich will das gar nicht weiterdenken – für die Gäste. Verdammt!, doch weitergedacht. Denn B: Nein, das wäre noch schlimmer. Ich will das nicht.
“Verdammt!”, rufe ich jetzt.
“Guck mal hier!”, mein Vater ratscht noch ein paar Mal am Spanngurt, “Das knackt richtig. Stefan, das kannst du nicht machen. Da ist so ein Zug drauf. Und da kommen ja noch Gäste rein. Stefan, das geht nicht!”
B: Ich muss die ganze Scheiße neu machen, ich muss die ganzen Löcher neu aufgraben und diese viel zu dünnen Pfosten rausholen, ich muss neue, viel dickere Pfosten besorgen, die Löcher weiter ausgraben, die neuen, viel dickeren Pfosten da rein stellen und alles wieder zumachen. Ich weine.
Mein Vater: “Stefan, nein. Neinneinnein, da musst du auch den Boden mehr verdichten. Da kannst du noch Steine, Feldsteine, Mauersteine oder so mit reinschmeißen und die dann mit verdichten. Aber so geht das nicht.”
“Ja!”, mein Frust ist in Worte gar nicht zu fassen. “Ja! Und was für Pfosten gibt es da noch? Im Baumarkt gab es keine dickeren.”
“Hier, am Deich, der Holzhandel, der hat doch Robinienstämme. Die sind doch dick genug.”
“Robinienstämme, ach ja!”, ich lache abfällig. So viel hab ich noch nicht über Natur gelernt, aber eins weiß ich schon, Robinienholz ist verdammt stabil, witterungsunabhängig, aber auch verdammt schwer. I break together.
“Mit deinem Anhänger, dann fährst du da ein paar Mal, wenn das für eine Ladung zu schwer ist. Aber das kriegst du schon hin”, mein Vater weiß Bescheid.
Ein paar Tage später. Tati und ich beim Holzhandel.
“Alles klar!”, stöhne ich, als ich einen Robinienstamm von über drei Metern Länge und 25 Zentimeter Breite anhebe.
“Was ist los?”, fragt Tati, die gerade noch aus dem Auto steigt.
“Ach, du, ne Kleinigkeit!”, betone ich so dumm es geht. “Ne Kleinigkeit. Wiegt nix. Nix!”
“Warte.”, Tati hebt jetzt auch an. “Äm, ja.”
“Ok. Was machen wir?”
“Fragen, ob jemand hilft?”
“Nene, warte. Wir gucken mal.”
Erst hebe ich die eine Seite, dann die andere. Stück für Stück wuchte ich das Teil vom Stapel bis es mit einem Knall auf den Boden fällt.
Keiner guckt.
Das mach ich nochmal. Und nochmal. Guckt immer noch keiner.
“Ist ja nicht so, dass hier mal einer helfen könnte.” moniert Tati.
“Jaja, nein, ist doch gut”, ich finde es gut.
Mit der gleichen Technik wuchte ich mit Tatis Hilfe die Stämme auf den Anhänger, der schon bei drei Stämmen fast zusammenbricht. Dann zahlen wir, sagen, dass wir für die anderen drei nochmal wiederkommen und fahren los.
Am Deich vor unserem Haus angekommen, beschließen wir, die Stämme einfach den Deich runterrollen zu lassen. Eine Lawine ist nichts dagegen. Der Stamm gewinnt nach den ersten zwei Metern derart an Geschwindigkeit, dass er auch von einer Dampflokomotive nicht mehr aufgehalten werden könnte. Zeitlupe – der Stamm dreht und fliegt über den Boden bis er schließlich einen alten groß gewachsenen Buchsbaum trifft. Ohne lautes Geräusch kommt der Stamm zum Stehen und lässt beim Aufprall die Stämme, Äste und Zweige derart erzittern, dass es an ein Wunder grenzt, dass nicht alle Blätter abgefallen sind. Wahnsinn. Das machen wir auch mit dem zweiten und dritten Stamm. Diesmal schmettern die Stämme allerdings gegeneinander. Der fast schon archaische Knall erinnert mich an die Szene aus Das Finstere Tal (wahnsinnig unterschätzter Film), bei der die Bergbauern große Holzstämme im Schnee über eine Art hölzerne selbstgebaute Rinne ins Tal gleiten lassen und dort auch mit einem gigantischen Knall an einem extra dafür gebauten Rammbock zum Halten kommen.
Bis die Balken in den Löchern stecken vergehen Stunden. Mein Rücken kennt jetzt ganz neue Schmerzen und ich habe wieder ganz neu Respekt vor den Menschen von früher, die hier gelebt und gearbeitet haben. Das war ihr Alltag und nicht eine Ausnahme wie bei mir.
Die nächsten Tage schmeiße ich noch ein paar Steine in die Löcher, die Erde auch und benutze zum Verdichten des Bodens nicht nur meine Füße, sondern auch ein weiteres tolles Werkzeug meines Vaters: Eine Metallstange mit Metallplatte am Ende. Es klopft jetzt deutlich härter.
Und jetzt der neue Versuch: Die Spanngurte werden erneut angelegt und langsam reihum gespannt. Diesmal knarrt nichts. Es biegt nichts und es passiert generell überhaupt nichts. Dann ist es soweit: Das Zelt hat eine grundsolide Spannung. Ich hole Tati und die Kinder, die irgendwas im Haus machen.
“Wer will zuerst?”, rufe ich.
Alles schreien. Tati auch.
Die Kinder und Tati im Zelt. Alles hält. Das Lachen der Kinder werde ich nie vergessen. Das von Tati auch nicht.
Als alle wieder weg sind, und alles ganz ruhig ist, lege ich mich ins Zelt. Ich schaue in die Baumkronen und begreife, das ist jetzt mein. Dieser Ort, dieses Zelt, diese hohen hohen Bäume, die ich erstaunt aus einer völlig neuen Perspektive bewundere, die sind jetzt auch mein. Mein Platz auf der Welt. All das, das stimmt, das kann auch alles wieder weggehen, kaputt gehen, ich sterbe auch irgendwann, aber heute, heute ist das mein Platz auf dieser Welt. Die Sonne strahlt durch die Äste in mein Gesicht. Es ist ein bisschen warm, und ich lache jetzt auch.
Ein Lied erklingt in meinem Kopf:
I am a tall tree
I weep like a willow
My scars are hiding
My branches don’t show
Yes, I am a tall tree
With roots like a new born
No wind is blowing
But over I go
And now I see storm clouds
Up in the distance
A terrible omen
A beautiful show
So take me down easy
Take me down easy
Let me land softly
Back in your arms
Take Me Down Easy – das erste Mal gehört in Bojack Horseman
James Henry Jr.
Ein so eine Sache, die ich erst gar nicht verstanden habe. Und bis heute – Jahre später – immer noch nicht. Wie das sein kann.
Es ist, als ob man in einer Blase lebt, ein Wattebausch. Als ob man in einem Raum aus Glas ist, jede Wand und Boden und Decke sind aus Glas, alles andere um dich herum ist da, aber man ist nicht dabei. Es findet statt, du findest statt, aber du bist nur Nebendarsteller, du wirst gelebt. Dante Alighieri – die Vorhölle. Du leidest keine Qualen, du siehst etwas Schönes, aber du wirst es nie erreichen. Eine ewige Sehnsucht, die nie erüllt wird.
Es ist ein Automatismus, der einsetzt, ich bin nie richtig da. Aber ich will da sein. Ich will das Leben leben, das ich lebe. Ich will es bewusst leben. Ganz da sein, nicht in einer Blase.
Nach schönen Ereignissen, wir besuchen die Großeltern, ein paar Tage Urlaub, Weihnachten oder so – es ist schon vorbei, bevor es angefangen hat. Es zerrinnt mir zwischen den Fingern. Die Zeit verzerrt sich zur Unkenntlichkeit. Vielleicht wird sie gar nicht schneller, sie ist einfach kaputt. Das Leben, wie es immer war, ist kaputt. Meine Gedanken, mein Denken.
2017 ziehen wir ein
Und dann ist auf einmal Mitte 2017, und wir verstehen gar nicht, wie das sein kann. Eineinhalb Jahre sind nun vergangen, unser Leben im Zeitraffer, die Kinder, unser Haus, unser Leben.
Das dauert vielleicht gar nicht mehr so lange. Unser Architekt macht uns Hoffnung, dass wir noch vor Weihnachten einziehen können. Dann ist das Haus nicht fertig, aber unser kleiner Wohnteil. Das macht uns Hoffnung und lässt uns das erste Mal überhaupt Luft, über Kleinigkeiten wie Wandfarben, Waschbecken oder Küche nachzudenken.
Eine Kleinigkeit war die große Wand in unserem Flett, das unser Wohnzimmer werden soll. Tati macht den Vorschlag, doch die Ölfarbe abzukratzen, damit die alte Fachwerkwand dahinter zum Vorschein kommt. Ich bin begeistert von der Idee, doch eine Kleinigkeit ist das leider so ganz und gar nicht. Denn diese Ölfarbe an sich ist ja schon schlimm genug. Wenn dann aber gleich drei oder vier Farbschichten übereinander liegen, ist das wirklich eine Nummer zu hart.
Ich probiere alles. Heißluftpistole mit Spachtel, Flex mit Spezialaufsetzen, Hammer und Meißel – für ein paar Quadratzentimeter brauche ich Stunden. Mein Hände schmerzen, die immer gleichen Bewegungen, ich werde high. Eigentlich müsste ich eine Maske tragen, aber ich bekomme keine Luft. Die Dämpfe, die bei der Hitze von der Ölfarbe freigesetzt werden, sind natürlich auch nicht optimal. Kann sich kein Mensch vorstellen.
Und dann ist es soweit: Wir ziehen mit den ersten Sachen – mal wieder – um. Der letzte Umzug ist noch gar nicht so lange her, aber wie das so ist mit unserem Projekt. Einfach kann ja jeder. Aber diesmal ziehen wir in unser altes Haus. In unser neues Leben.
Ich sehe mich von außen. Das Bild, das für die Ewigkeit bleibt. Die erste Nacht in unserem Traumhaus. Wir haben eine Hochebene über dem Wohnzimmer bauen lassen, die jetzt unser Schlafzimmer sein wird. Die Mädchen schlafen in der guten Stube, dem schönsten holzvertäfelten Zimmer des Hauses, David in dem Zimmer rechts daneben.
Das ist ganz dunkel. Nur ein schwaches Licht erleuchtet das große Flett. Da steht eine hohe Leiter vor unserer Hochebene und wir sitzen am Rand und gucken in den Raum, ins große stille Dunkel, so als ob wir die Zukunft erahnen könnten.
Jetzt und hier.
Dieser eine Moment. Jetzt geht es los. Über zehn Jahre auf diesen Moment hingearbeitet.
Könnte ich ihn nur festhalten. Das wissen wir ganz genau, dass dieser Moment ein Mal da ist, und dann nie wieder. Nichts ist für die Ewigkeit. Nichts kann man auch nur eine Sekunde verlängern, was nicht mehr da ist. Eine Stunde, war es eine halbe, war es vielleicht nur eine Minute, die dieses Gefühl in uns auslöste?
Jetzt beginnt das Abenteuer. Jetzt ist es real. Wir sind da. Die Kinder sind da. Das Haus ist da. Das ist real. Es geht nicht in unsere Köpfe. Aber der Moment bleibt in unserer Erinnerung, und dann schlafen wir ein. Tati ein bisschen früher, wie immer, ich ein bisschen später.
Am nächsten Tag ist der Alltag wieder da. Denn ganz so romantisch ist es dann doch nicht. Möbel, Kisten, Kartons, Gerätschaften, Säcke und so weiter und sofort stapeln sich bis fast unter die 3,70m hohe Decke – man kann kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Wir so mitten drin. Und die Bergedorfer Zeitung wieder dabei. Wir freuen uns.
Als der Artikel mit uns erscheint, bekommen wir auch erste Anfragen zu Feiern oder zum Café – das läuft doch schon mal ganz gut.
Und so sitzen wir dann auch das erste Mal als Familie gemeinsam am Tisch und frühstücken gemeinsam in unserem neuen alten Haus.
Die nächsten Wochen bleiben leider nicht derart entspannt, denn wir sind immer noch Teil einer Großbaustelle. Das hämmert, das bohrt, das kratzt, das hobelt, das zurrt, ruft, pustet oder ruft aus allen Ecken und Endes des Hauses. Morgens beim Frühstück vor der Arbeit – Zimmerer über dir, die die Treppenkonstruktion für die Treppe vor der Dachbodenwohnung über uns machen. Nachmittags kurz Mittagsschlaf – eine Lieferung Leisten. Die Kinder von der Schule abholen – aber vorher schnell noch die Position des Waschbeckens in der Diele bestimmen.
Das geht noch Wochen, Monate. Unsere Nerven sind nicht mehr existent. Wir gehen nicht auf Zahnfleisch, wir gehen auf Knochen. Oder Gehirn. Nichts mehr übrig.
Kr. Krrr. Krkrrkrr. Krkrkr.
“Schatz, was ist das?”, wecke ich Tati mitten in der Nacht. Wir schlafen jetzt seit einiger Zeit auf der Hochebene.
“…”
“Schatz!”
Krr. Kr. Krkrkrkrrr.
“Schatz, jetzt hör doch mal!”, ich rüttel sie jetzt richtig wach.
“Was, Schatz, bist du wahnsinnig, es ist mitten in der Nacht!”
Krkrkrkrkr.
“Hast du es nicht gehört?”
Krkrkrkr.
“Doch ja, ist ja gut. Keine Ahnung, ist doch egal!”
Krkrkrkrkrkr.
“Wo kommt das her?”
“…”
“Schatz!?”, sie ist schon wieder eingeschlafen. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Vorsichtig schleiche ich mich aus dem Bett, nein, ich drehe mich auf dem Bett, auf dem Hochebene ist nicht wirklich viel Platz, und horche an der Wand.
Krkrkrkrkr. Krkrkrrrr. Krr.
Ich schlag rauf!
“Schatz!”, Tati ist wieder wach. “Spinnst du? Was ist los bei dir?”
“Hier ist was. Da ist was in der Wand!”
“Alter, das ist mir egal! Lass mich schlafen!”
“Das ist eine Maus oder so!”
Krkrkrkrkr.
“Ist doch egal!”, schnautzt Tati mich an. “Komm jetzt wieder her und sei ruhig!”
Krkrkrkrrr.
Da komm ich ja nie wieder rein. Die Wand ist fertig. Das ist so eine Leichtbauwand, innen hohl und so. Ich werde wahnsinnig. Wenn das eine Maus ist, da kann die da ja auch Kabel anfressen oder so, und dann brennt gleich wieder unser ganzes Haus ab. Lebenstraum im Arsch, Maus in der Wand.
Am nächsten Tag gehe ich ums Haus und stopfe jedes noch so kleine Loch mit Drahtgitter oder sonstwas, damit da keine Maus mehr reinkommen kann. So viele Löcher waren das gar nicht mehr.
Doch in der Nacht, wieder Krkrkrrkrkr.
“Schatz!”
Sie hört mich nicht mehr.
Krkrkrk. Krkrk.
Mein Herz wird immer lauter, ich steigere mich da richtig rein. Soll ja wohl ein Witz sein. So weit gekommen und jetzt kommt so ein wenige Zentimeter gro0es Ding an und zerstört unseren Traum?
Krrkrkrk. Kr. Kr. Krkr.
Ich schlag da wieder gegen.
“Schatz!”, Tati ist wieder was. “Bist du bescheuert? Ich meine, bist du jetzt komplett durchgedreht?”
“Schatz, ich habe Angst, was sollen wir machen, wenn die Kabel anfressen?”
“Die fressen keine Kabel an. Da müssten doch alle Häuser abbrennen!”
“Ja, tun sie ja auch!”
“Quatsch!”
“Schatz, bitte, was sollen wir denn machen?”
“Schlafen!”, sie dreht sich wieder um.
Ich kann nicht schlafen. Krkrkrkrk. Das geht die ganze Zeit so, warum kann Tati da überhaupt schlafen, das muss sie, krkrkrkr, doch auch beschäftigen, krkrkrk, krrrr, krkr, dass unser Haus demnächst abbrennt, krkrkr, Mausefallen, ja, gute Idee, Mausefallen, die besorge ich und stelle sie überall auf, krkrkrkr, und dann ist das Problem gelöst.
Krkrkrkr.
Drei Mausefallen pack ich da rein. Bei der Tür unter der Hochebene, da sind auch noch Löcher in der Wand, wo sie durchkommen könnten.
Und tatsächlich. Nach einigen Tagen ist da die erste Maus drin.
Meine erste Maus.
Ich habe noch nie eine Maus mit einer Mausefalle gefangen. Ich habe noch nie irgendein Tier gefangen oder gar getötet. Niedlich sieht die da aus. Und traurig. So klitzeklein, wie die ist, das wusste ich gar nicht, wie klein diese Mäuse sind. Ich denke darüber nach, dass ich Fleisch esse. Und da sterben ja noch viel größere Tiere. Und dann denke ich darüber nach, was die Menschen sich wohl früher gedacht haben. Und dann möchte ich aufhören zu denken. Denn ich denke immer viel zu viel.
Die nächsten Tage erwische ich noch ein paar Mäuse, aber das Krkrkrkr hört nicht auf.
Tage vergehen, Wochen vergehen, bis ich eines Tage bei unserer Terassentür zum Garten zufällig entdecke, wie eine Maus zwischen einem Treppenstein und einem Holzbalken verschwindet. Die kommt da auch nicht mehr raus. Ich warte da ein paar Minuten. Nichts. Schnell suche ich ein dünnes Brett und klemme es zwischen Stein und Holz.
Von diesem Tag an konnte ich ruhig schlafen.
Dingdong. Unsere Nachbarin von links nebenan steht vor der Tür. Wir freuen uns und bitten sie herein. Sie verneint mit einem Lächeln, sie hat zu Hause noch viel zu tun, überreicht uns aber ein großes Paket.
“Als kleines Willkommens-Geschenk”, sagt sie und verschwindet wieder im Dunkel.
Wir bedanken uns und sind gespannt. Ein großes Lebkuchenhaus kommt zum Vorschein, als wir das Geschenk auspacken und sind ganz begeistert, wie nett wir doch empfangen werden.
Leider ist dieses Kapitel auch schnell wieder vorbei, denn – man kann es sich schlecht vorstellen, aber es war für uns einfach so – wir hatten im Dauerstress die Nachbarn nie so richtig mitgenommen. Natürlich haben wir uns vorgestellt, aber, was, wie, wann und so weiter bei uns und mit unserem Haus kommen sollte, das hätten wir besser kommunizieren können und tut uns bis heute leid. Wir hatten lange Zeit einfach nur funktioniert und waren froh, dass nichts komplett aus dem Ruder gelaufen und unsere Familie nicht auseinandergebrochen ist.
Dann wird es kalt und wir wissen, warum uns die alte Besitzerin des Hauses gesagt hat, dass das hier eine raue Ecke sei.
Das Land des Windes
Es war einmal das Land des Windes. Das lag am letzten, am letzt verbliebenen östlichen Zipfel der altehrwürdigen Hansestadt Hamburg. Eine raue Ecke mit rauen Menschen und rauen Sitten.
Der Elbstrom peitschte hier mit besonderer Inbrunst gegen die Deiche, und die Bäume gaben schon lange auf, dem Wind etwas entgegenzusetzen. Sie verbündeten sich mit ihm, sie beugten, sie verbeugten sich als Dank, nicht ganz zu brechen, so dass ein jeder sehen würde, wer hier das Sagen habe. Als Gegenleistung gab der Wind immer genug frische Luft und ausreichend Regen.
Zur Zeit des Winters bäumte sich der Wind besonders auf. Er wehte zu jeder Tages- und Nachtzeit. Immer hatte er den Regen im Gepäck. Wege, Deiche, ein paar befestigte Straßen, Äcker und Felder, alles versank unter einer dicken Schicht aus Matsch und Geäst.
Die Menschen verkrochen sich in ihren reetgedeckten Häusern und verriegelten die Fenster mit ihren ganz sonderbaren, nach unten geklappten Fensterläden. Das Feuer im Flett loderte und der Wind peitschte mit aller Kraft gegen das Fachwerk. Welch große Kunst doch diese Häuser sind, die da schon immer so standen. Welch großen Schutz sie ihren Besitzern doch schon immer gaben.
Die Tage und Wochen und Monate vergingen. Der Wind wurde nicht müde, immer weiter zu blasen und zu stürmen, umzureißen und umzubrechen. Und die Menschen begannen, sich zu fragen, warum der Wind gerade hier so tobte.
Eines Tages kam ein junger Mann aus fernen Landen, verirrt, fast verhungert und von einer ganz geheimnisvollen Ausstrahlung. Er klopfte am ersten Haus, aus dem Licht hervorleuchtete und wurde eingelassen.
Völlig entsetzt nahmen die Bewohner des Hauses den Mann auf und kümmerten sich drei Wochen und vier Tage um ihn. In der Zeit sprach er kein Wort.
Am fünften Tage nach drei Wochen und vier Tagen jedoch, als der Winter auf dem Rückzug war, erhob er und bedankte sich in einer Sprache, die niemand verstand. Er verließ das Haus und zog von dannen. Niemand wusste, was es zu bedeuten hatte.
Das Land des Windes vergaß ihn schließlich und seine Bewohner lebten weiter ihr karges Leben.
Im fünften Jahr, im dritten Monat, am vierten Tage nachdem der Fremde die Bewohner des Hauses am Elbdeich verlassen hatte, kehrte er zurück. Es war Sommer und eine Hitze, wie es sie noch nie gegeben hatte. Die Ernte würde schlecht ausfallen, man konnte nur hoffen, dass alle Bewohner im Land des Windes genug Nahrung über den Winter bekommen würden. Der Fremde sprach nun auch die Sprache der Bewohner. Er erzählte ihnen, dass er gekommen war, um eine Zeit lang mit dem Wind zu leben. Denn da, von wo er herkam, gab es keinen Wind. Da, wo er herkam, war es immer so wie zu dieser Zeit. Die Sonne brannte vom Himmel. Keine Wolke trübte die Hitze und kein Regen fiel auch nur einen Tag im gesamten Sommer. Der Wind kehrte zu dieser Zeit dem Land, dem er doch immer treu war, den Rücken.
Von da an erkannten die Bewohner im Land des Windes, warum es gut war, dass es den Wind gibt. Von da an zweifelte niemand mehr daran. Und der Wind kam wieder. Noch rechtzeitig, und seine Bewohner mussten nicht hungern. Im Land des Windes.
Das ist nicht nur kalt. Das ist saukalt. Wir konnten zwar in unsere Wohnung einziehen, aber fertig ist sie noch lange nicht.
Der Wind pfeift durch alle Ecken und einer nach dem anderen erkältet sich. So geht das nicht weiter. Die Tür, die verdammte Haustür. Die ist alt, aber nicht so alt. Es lohnt sich nicht, sie zu erhalten, deswegen müssen wir mit ihr Leben, bis die neue da ist. Und die jetzige ist einfach nicht ganz dicht.
Ich nehme Gaffa-Tape und klebe jede Ritze damit zu. Die Tür geht nie wieder auf. Egal, Hauptsache wir frieren nicht mehr.